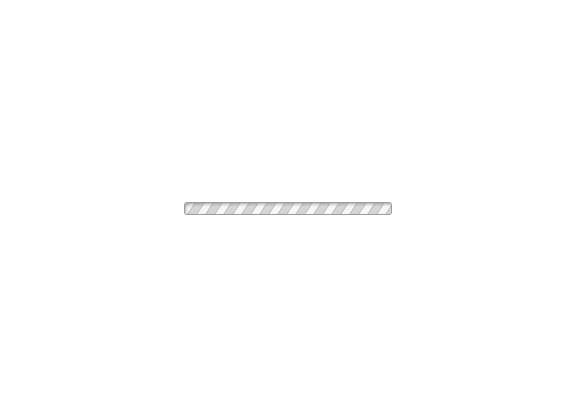Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier beim Festakt zum 50. Jahrestag der Veröffentlichung der Ostdenkschrift „Versöhnung und Verständigung als Leitlinie politischen Handelns“
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, Professor Bedford-Strohm,
Eminenzen,
Exzellenzen,
sehr geehrte Frau Präses Dr. Schwaetzer,
meine Damen und Herren,
„Verständigung und gar Versöhnung können nicht durch Regierungen verfügt werden, sondern müssen in den Herzen der Menschen auf beiden Seiten heranreifen.“
Es war Willy Brandt, der diesen Satz im Jahr 1970 zum polnischen Ministerpräsident Josef Cyrankiewicz sagte. Cyrankiewicz hatte die Konzentrationslager Auschwitz und Mauthausen überlebt. Nun standen beide gemeinsam im Palais des polnischen Ministerrats und unterzeichneten ein Dokument, das die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen „normalisieren“ sollte, den Warschauer Vertrag.
Dazu, dass Brandt dort stehen konnte, und dazu, dass eben jener Wunsch nach Versöhnung in den Herzen der Deutschen und Polen reifen konnte, vom dem er damals sprach, dazu hatten die Evangelische Kirche in Deutschland und die polnischen Bischöfe fünf Jahre zuvor einen entscheidenden Anstoß gegeben.
Die Ostdenkschrift der EKD markierte 1965 eine Zäsur in den Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Ein Zäsur, weil die Verfasser mutig eine Tür aufstießen zu einer Debatte, die bis dahin in deutschen Regierungsbüros, aber auch an deutschen Küchentischen in dieser Form nicht stattgefunden hatte: Es ging um die großen Fragen deutscher Schuld, deutscher Verantwortung und um die Grenze zum Nachbarn Polen. Um Themen also, die man scheute – auch in der Politik. Die unser Land aber angehen musste, damit der Weg zur Versöhnung frei werden konnte.
Die Schrift würdigte die schlimmen menschlichen Folgen der Vertreibung. Doch sie mahnte zugleich, die Unrechtstaten gegenüber Deutschen im Zusammenhang zu sehen, zu den furchtbaren Verbrechen der Nationalsozialisten, zum Leid und zum Schrecken, die von Deutschland ausgegangen waren. Die Verfasser ermutigten die Deutschen zur Versöhnung mit den östlichen Nachbarn und tasteten das Tabu der Anerkennung der Oder-Neiße Linie an.
In Polen baten die katholischen Bischöfe wenige Wochen später in ihrem bemerkenswerten Brief um die Vergebung polnischer Schuld, und gewährten sie für die deutsche. Trotz oder gerade wegen der „fast hoffnungslosen Vergangenheit“, hieß es, sollte der Hirtenbrief der „Anfang eines Dialogs“ sein. Auch das ist unvergessen.
Die Schriften waren ein Wendepunkt – so hat der polnische Präsident Andrzej Duda es vor wenigen Wochen bei seinem Berlin- Besuch mir gegenüber beschrieben.
Auf der einen Seite dieses Wendepunkts stehen die dunkelsten Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte: Der deutsche Überfall auf Polen; die Grauen und Verbrechen des NS-Regimes, begangen auf polnischem Boden, an polnischen Bürgern.
Auf der anderen Seite dieses Wendepunkts jedoch, steht die positive, die wunderbare Entwicklung unserer Beziehungen, die mit der Ostdenkschrift begann und sich zu großer Dichte und Freundschaft entwickelt hat. Die Stationen dieses Weges:
- In Deutschland: Die neue Ostpolitik unter Brandt und Egon Bahr. Der Kniefall Willy Brandts am Warschauer Ghetto.
- In Polen: Die Kraft und der Mut von „Solidarnosc“, die einen in Osteuropa beispiellosen Druck von unten auf die Machthaber ausübte. Wir alle erinnern uns an den Besuch von Papst Johannes Paul II. in Polen im Jahr 1979. Seine Worte des Mutes wirkten wie eine Initialzündung zur Überwindung der kommunistischen Herrschaft. Das polnische Volk hat sich mit seiner unbeugsamen Liebe zur Freiheit im Geschichtsbuch Europas verewigt.
- In unseren beiden Ländern war es der Freiheitswille der Menschen, der schließlich die Mauer zu Fall brachte und die europäische Einigung ermöglichte.
- Und noch heute sind wir dankbar für die unglaubliche Großmut, mit der uns die polnischen Nachbarn nach der Wiedervereinigung die Hand gereicht und den Weg zum Freundschaftsvertrag frei gemacht haben
Die Ostdenkschrift war Wendepunkt zwischen Leid und Zuversicht, zwischen dem Blick in eine trennende Vergangenheit und dem in die gemeinsame Zukunft.
Innerhalb der Kirche wurde in Deutschland heftig diskutiert. Nicht nur um den Inhalt der Schrift selbst ging es, sondern auch um die gesellschaftliche und politische Rolle der Kirche. Um Fragen also, die, wie ich vermute, viele von Ihnen hier im Saale umtreiben. Auch immer wieder mich persönlich: als Politiker und als Christ.
Für mich ist erhellend, was der große reformierte Theologe Karl Barth im Jahr 1919, also fast 50 Jahre vor der Ostdenkschrift, in seiner berühmten Rede zum „Christ in der Gesellschaft“ sagte. Barth formulierte darin ein flammendes Bekenntnis zur christlichen Botschaft, die alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft durchdringt. Sie ist eine Kraft der Veränderung und der Erneuerung, die gleichzeitig davor schützt, den momentanen Zeitgeist als letzte Wahrheit zu betrachten. Eine Kraft, die erkennt, was in der Gesellschaft notwendig ist; die Menschen frei macht von unwürdigen Zwängen.
Eine Kraft, die Verantwortung übernimmt, auch wo es schwierig wird. So, wie die Autoren der Ostdenkschrift es rund 50 Jahre nach Barths Rede wagten.
In Deutschland zeigte damals auch die Politik Mut, erstarrte Positionen zu revidieren. Egon Bahr, den wir letzte Woche an seine letzte Ruhestätte begleitet haben, hatte in seinem berühmten Vortrag in der Evangelischen Akademie Tutzing 1963 die Losung des „Wandels durch Annäherung“ ausgegeben, die Grundlage für die neue Ostpolitik, für eine Öffnung gegenüber den östlichen Nachbarn. Als Grundaxiom hielt Bahr fest, dass es „zunächst um die Menschen zu gehen“ hat „und um die Ausschöpfung jedes denkbar und verantwortbaren Versuchs“, deren Zukunftschancen zu verbessern. Und so setzten Bahr, Brandt und ihre Mitstreiter politisch fort, was die Ostdenkschrift gesellschaftlich angestoßen hatte: Den Wunsch nach Verständigung und Versöhnung, der in den Herzen der Deutschen gereift war, wie Brandt es formuliert hatte.
***
Auch heute, glaube ich, brauchen wir beides auf dem Weg der Verständigung mit unseren Partnern: Zum einen den politischen Rahmen – Verhandlungen, Abkommen und Institutionen. Aber zum anderen ist klar, dass dieser politische Prozess nur dann funktionieren kann, wenn er getragen wird vom Willen der Menschen, diese Zusammenarbeit mit Leben zu füllen.
An unseren Beziehungen zu unseren polnischen Nachbarn ist dies besonders sichtbar. Politisch sind wir heute so eng verbunden wie noch nie zuvor in unserer wechselvollen Geschichte. Aber diese politische Freundschaft wird getragen von den unzähligen zivilgesellschaftlichen Initiativen, den kirchlichen, kulturellen und persönlichen Verbindungen zwischen den Menschen unserer beiden Länder.
Ralf Dahrendorf hat das Wort von der „Außenpolitik der Gesellschaften“ geprägt. Er meint damit: Nicht nur Staaten und Außenministerien gestalten die Beziehungen zwischen den Ländern, sondern zu allererst die Menschen. Ich glaube, was zwischen den Menschen in Polen und Deutschland gewachsen ist, kommt dieser Vorstellung recht nahe.
Allein, wer durch Berlin spaziert, weiß, was ich meine. Mehr als 50.000 Polinnen und Polen leben in dieser Stadt. Die wunderschöne Sprache von Czesław Milosz und Wisława Szymborska ist überall präsent. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass auch noch mehr junge Deutsche Polnisch sprechen. Unzählige Schul- und Universitätspartnerschaften helfen, junge Menschen neugierig zu machen auf das andere Land. Das deutsch-polnische Jugendwerk und die europäische Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder sind herausragende Kooperationsprojekte.
Offener Austausch spielt in diesem engen Geflecht unserer Beziehungen eine wichtige Rolle. Über das Dokumentations- und Informationszentrums der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ haben wir heftig gestritten. Ich bin überzeugt: Wenn wir sie im Geist der Versöhnung und der Freundschaft führen, dann wird die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte, insbesondere den Schrecken des letzten Jahrhunderts, Polen und Deutsche einander noch näher bringen. Dabei ist eines essenziell: die Perspektive des anderen zu respektieren – aus damaliger Sicht und aus der heutigen.
***
Meine Damen und Herren,
Unsere Gesellschaften sind heute auf so vielen Ebenen fest miteinander verflochten, dass die Zukunft unserer Beziehungen unabhängig von Tagespolitik und Wahlentscheidungen auf Zusammenarbeit gestellt ist.
Im nächsten Jahr feiern wir ein großes Jubiläum: 25 Jahre Nachbarschaftsvertrag! Doch nicht nur das. Wir feiern auch – gemeinsam mit unseren französischen Freunden - 25 Jahre Weimarer Dreieck, und damit unsere enge Freundschaft in und für Europa. Und für mich ist dies bedeutend: Denn ich glaube, gerade weil unsere bilateralen Beziehungen so eng sind, müssen wir unseren Blick heute darüber hinaus richten – auf Europa.
Deshalb wollen wir uns nächstens Jahr nicht auf das Feiern des Erreichten beschränken. Wir wollen auch zusammen arbeiten. Dazu habe ich eine Arbeitsgruppe der beiden Außenministerien vorgeschlagen, die eine auf Europa ausgerichtete deutsch-polnische Zukunftsagenda entwirft – vielleicht nicht unbedingt für die nächsten 25 Jahre, aber doch weit über den Tag hinaus.
Aus meiner Sicht müssen gerade Polen und Deutschland als enge Partner in der Mitte - im Herzen - Europas dabei helfen, gemeinsame Antworten auf unsere europäischen
Frage zu finden. Wir müssen dringend eine neue europäische Asylpolitik auf den Weg bringen. Unsere Politik muss dabei unseren europäischen Prinzipien gerecht werden: Dem Prinzip der Humanität zum einen. Eines Europas, das Notleidende aufnimmt, ihnen Schutz bietet, schnell, sicher und menschenwürdig, egal wo in Europa sie ankommen. Und zum anderen dem Prinzip der Solidarität. Die europäischen Werte sind gemeinsame Werte, die wir gemeinsam zu verteidigen haben. Weder die geographische Lage, noch Größe, noch statistische Wirtschaftsdaten dürfen dazu führen, dass nur einige die Flüchtlingslast tragen, die große Mehrheit aber nicht. Im Gegenteil: nur wenn sich keiner entzieht, wird die Herausforderung Migration zu bestehen sein.
Deshalb brauchen wir eine schnelle europäische Einigung darüber, wie wir zu einer fairen Teilung der gemeinsamen Verantwortung finden. Dieses handfeste Zeichen der Solidarität müssen wir gemeinsam setzen – nicht irgendwann, sondern bald, bevor die große Hilfsbereitschaft der Menschen, die wir in diesen Tagen sehen und für die wir dankbar sind, in Enttäuschung über europäische Handlungsunfähigkeit umschlägt.
In der Flüchtlingsfrage erleben wir einmal mehr, was schon in der Eurokrise zu spüren war: Unsere Antworten auf die großen Fragen der Gegenwart können nur europäisch sein. Und eine „europäische Antwort“ zu geben, heißt eben nicht: den Bürgern im eigenen Land zu zeigen, dass die Regierung in der Lage war, ihre jeweiligen nationalen Interessen in Brüssel durchzuboxen. Sondern es heißt, eine andere, eine gemeinsame Perspektive einzunehmen und zu fragen: Was ist die Lösung, die für Europa insgesamt trägt?
In der Konsequenz mag das für uns alle in Europa immer häufiger auch heißen, dass wir manches Mal bereit sein müssen, unbequeme innenpolitische Debatten in Kauf zu nehmen, um in großen europäischen Fragen voranzukommen. Die Diskussion um das dritte Griechenland-Paket hat das uns Deutschen deutlich gezeigt. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen: In Sachen Migration wird das nicht anders sein. Das ist auch ein Lernprozess, - wohl nicht nur hier bei uns im Lande. Wir müssen erkennen: Verantwortung in Europa übernehmen, das heißt immer auch bereit sein zum Verständnis des Partners, zum geduldigen Feilen an Kompromissen, zur gegenseitigen europäischen Solidarität.
Was mich optimistisch stimmt, ist, dass große Teile der Bevölkerung – und der Kirchen! – uns schon heute in der Flüchtlingskrise zeigen, was es heißt, unsere europäischen Werte ernst zu nehmen. Was es heißt, Menschlichkeit und Solidarität zu leben.
Die evangelischen Landeskirchen, der Ratsvorsitzenden, der heute hier ist, Papst Franziskus – alle haben in den letzten Tagen Gläubige in ganz Europa aufgerufen, Flüchtlingen Schutz zu gewähren. Und schon jetzt sind unzählige Freiwillige auf den Beinen – an Bahnhöfen, in Erstaufnahmelagern, in Schulen und Kirchen - um Schutzsuchende mit dem Nötigsten zu versorgen. Um ihnen zu helfen, hier anzukommen und sich bei uns willkommen zu fühlen. Auch in Polen engagieren sich die Gemeinden, hat man mir berichtet. In Posen spenden Gläubige, um die Aufnahme von Flüchtlingen zu ermöglichen. Das Erzbistum Breslau hat die Aufnahme mehrerer Familien angekündigt. Auch bei uns zuhause ist die Kirche aktiv. In Sachsen begleiten Gemeindemitglieder Flüchtlinge zu Arztbesuchen. In Hamburg lernen syrische Kinder in evangelischen Gemeinden deutsch. In niedersächsischen Pfarreien stapeln sich Kleiderspenden neben den Gesangbüchern.
Die Gesellschaft tritt in Vorlage, so hat es kürzlich ein Fernsehjournalist im Gespräch mit mir formuliert.
Und es stimmt: Das zivilgesellschaftliche Engagement in vielen Ländern Europas ist inspirierendes Beispiel. Aber es ist auch eine klare Aufforderung an uns in der Politik. Es ist sogar eine Aufforderung zu Politik!
Denn auch die Menschen, die jetzt mit großem Engagement und Einsatz helfen, fragen: Wieviel kann Deutschland leisten? Und wie werden wir der Situation auf lange Sicht Herr?
Die Frage ist berechtigt! Und klar ist: Auf lange Sicht wird uns das nur gelingen, wenn wir unseren Blick auf die Fluchtursachen lenken: Auf die Herkunftsländer der Flüchtlinge und auf jene Länder, die sie auf ihrem gefahrvollen Weg nach Europa durchqueren. Warum kommen denn gerade jetzt so viele Menschen aus dem Mittleren Osten und über Nordafrika zu uns? Die Ursache für Flucht sind meist politische Konflikte, die auch politisch gelöst werden müssen. Damit die Flüchtlinge in eine Heimat zurückkehren können, die ihnen wieder Sicherheit und Perspektiven bietet. Genau dies ist es doch, wonach sich die meisten Menschen sehnen, die den gefährlichen Weg nach Europa auf sich nehmen! Deswegen dürfen und werden wir nicht nachlassen in unseren Bemühungen, politische Lösungen für die Konflikte im Mittleren Osten und in Nordafrika zu finden. Das sage ich mit Blick auf Syrien. Das sage ich aber auch mit Blick auf Libyen, wo wir jetzt - nach monatelangen Gesprächen – die Hoffnung haben, dass es zu ersten wichtigen Schritten auf dem Weg zu einer Lösung des Konflikts kommt.
Klar ist: Die Ursachen und Auswirkungen der Flüchtlingskrise können wir in Europa nur gemeinsam angehen. Und deswegen will ich enden mit den Worten eines großen Europäers, mit Władysław Bartoszewski. Bartoszewski, der im April verstorben ist, hat sich wie kein zweiter um die deutsch-polnische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg verdient gemacht. Er, der Auschwitz überlebt hatte, war ein Versöhner, ein Brückenbauer. Und ich freue mich sehr, dass Bartoszewski posthum im nächsten Jahr die wichtigste Ehrung unserer beider Regierungen erhalten wird: den Deutsch-Polnischen Preis.
Bereits vor 20 Jahren hat er es im Deutschen Bundestag so ausgedrückt: „Die Zusammenarbeit (unserer) beiden Staaten im geeinten Europa gehört heute zu den wichtigsten Zielen und Begründungen unserer bilateralen Beziehungen. Sie verleiht ihnen den Sinn. Und liefert dafür vielerlei Motivationen -- mit Blick auf die junge Generation von Polen und die junge Generation von Deutschen. Auf die, so walte Gott, glücklichen Menschen des 21. Jahrhunderts.“
Mit Mut und Weitsicht sprach Bartoszewski diese Worte vor 20 Jahren. 30 Jahre zuvor, vor 50 Jahren, waren es der Mut und die Weitsicht der Verfasser der Ostdenkschrift, die unserem Land den Weg zur Versöhnung mit unserem Nachbarn Polen bahnten. Was heute in wunderbarer Weise Realität geworden ist, dazu gaben sie vor einem halben Jahrhundert den Anstoß. Das war mutig. Das war wichtig. Das war wegweisend für unsere Freundschaft in Europa.
Und dafür gilt ihnen bis heute unser Dank!