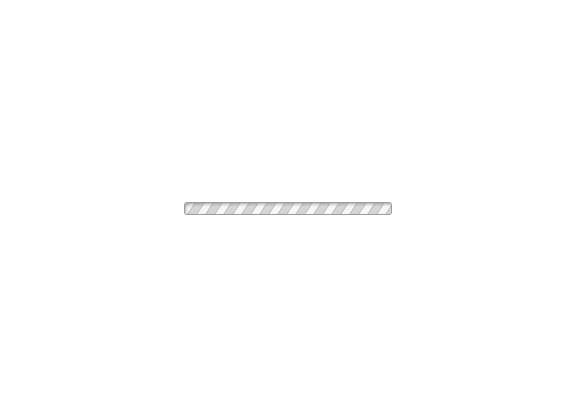Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Außenminister Guido Westerwelle im SPIEGEL-Gespräch
Herr Außenminister, in Japan ereignet sich gerade eine nukleare Katastrophe. Neigt sich das Atomzeitalter dem Ende zu?
Es gibt Ereignisse, die bedeuten einen so tiefen Einschnitt, dass danach nichts mehr so ist wie vorher. Der Terrorangriff vom 11. September 2001 war so eine Zäsur. Und die Katastrophe in Japan ist es auch.
Denken Sie über die Atomenergie jetzt anders als vorher?
Ich habe im Lagezentrum des Auswärtigen Amtes hautnah miterlebt, wie sich die Situation in Fukushima immer mehr zugespitzt hat. Es spielten sich erschütternde, herzzerreißende Szenen ab. Mir war sofort klar, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Deshalb habe ich mit der Bundeskanzlerin das Moratorium vereinbart. Es muss jetzt alles überprüft werden.
Kritiker vermuten hinter dem Moratorium ein Wahlkampfmanöver.
China will seine Atompolitik überprüfen, die USA wollen die Sicherheitsstandards überdenken. Indien und Russland haben ähnliches angekündigt. Weltweit hat das Nachdenken eingesetzt. Das allein zeigt schon, dass es unangemessen ist, der Bundesregierung Wahlkampftaktik vorzuwerfen.
Sie haben das Energiekonzept der Regierung vor einem halben Jahr als epochal bezeichnet. Eine sehr kurze Epoche.
Wir haben als Bundesregierung entschieden, eine Brücke ins Zeitalter der regenerativen Energien zu bauen. Das habe ich mit epochal gemeint, und das gilt unverändert.
Die Brücke hat vor Ihnen bereits die rot-grüne Bundesregierung gebaut.
Es ist keine Lösung, die sichersten Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, um am Tag danach Atomstrom aus dem Ausland zu beziehen. Wir haben in unserem Energiekonzept ein verantwortungsvolles Auslaufen der Atomenergie beschlossen. Das war der Unterschied zum rot-grünen Konzept.
Wenn es so verantwortungsvoll war, wieso muss jetzt alles neu geprüft werden?
Es wäre fahrlässig, wenn wir nach einem solchen Ereignis wie in Japan sagen würden, wir machen einfach weiter wie bisher. Bislang sind wir in unseren Risikoszenarien von menschlichem oder technischem Versagen ausgegangen. Jetzt haben wir es mit einem Naturereignis unvorstellbarer Macht zu tun. Man muss jetzt aus einem neuen Blickwinkel noch einmal auf die Sache schauen.
Restrisiko hieß bis zu den Vorfällen in Fukushima im Bewusstsein der Bevölkerung: Es kann eigentlich nichts passieren. Was heißt Restrisiko heute?
Das ist eine zentrale Frage, die wir uns stellen müssen. Die kann ich Ihnen heute noch nicht abschließend beantwortern. Ein entscheidendes Problem in Fukushima war zum Beispiel der Ausfall der Kühlsysteme. Da stellt man sich natürlich die Frage: Kann das bei uns auch passieren? Deswegen brauchen wir dieses Moratorium, um zu untersuchen, was wir aus den Vorfällen lernen können.
Wir wissen seit der vergangenen Woche, dass es zu Situationen kommen kann, in denen die Atomtechnik nicht mehr beherrschbar ist. Reden wir jetzt über das Abschalten von sieben Reaktoren und von besseren Kühlsystemen? Oder reden wir darüber, ob wir dieses Risiko überhaupt noch eingehen wollen?
Dass wir von der Kernkraft weg wollen, ist doch längst entschieden. Nur müssen wir ehrlich sagen, dass wir heute unseren Energiebedarf noch nicht mit Sonne, Wind und Wasser decken können. Wir können natürlich mehr Kohle und Gas verbrennen, aber das ist auch nicht risikolos. Denken Sie an den Klimawandel. Das Moratorium ist keine bloße Vertagung. Die Dinge sind danach anders.
Das heißt, die deutschen Atomkraftwerke werden nicht so lange laufen wie geplant?
Ich wäre mit den konkreten Schlussfolgerungen vorsichtig. Ich maße mir nicht an, so wenige Tage nach dem Ereignis schon eine ausreichende Antwort zu haben, was alles zu tun sein wird.
Angela Merkel ist nicht so vorsichtig. Aus ihrer Regierungserklärung lässt sich schließen, dass sie schneller aus der Kernenergie aussteigen will, als es die Koalition im Herbst beschlossen hat.
Ich interpretiere die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin nicht. Ich habe Ihnen meine Meinung gesagt. Und so haben wir in der Bundesregierung entschieden.
Fürchten Sie die juristische Auseinandersetzung mit den Energieunternehmen? Selbst in ihren eigenen Reihen wird gefragt, ob das Moratorium eine rechtliche Grundlage hat.
Mein Vater, der Zeit seines Lebens ein engagierter Rechtsanwalt war, würde das typisch nennen: Die Regierung trifft nach einer Katastrophe ungekannten Ausmaßes eine schnelle, beherzte und notwendige Entscheidung – und wir diskutieren über die Frage der Paragrafen.
Wir erwarten schon, dass eine Regierung sich auch in schwierigen Situationen nicht über die Gesetze hinwegsetzt.
Davon kann auch keine Rede sein. Der Bundesumweltminister hat als zuständiger Minister erklärt, dass Paragraf 19 Absatz 3 Ziffer 3 des Atomgesetzes eine hinreichende rechtliche Grundlage ist. Mir scheint die Debatte ein Ablenkungsmanöver zu sein. Unsere Kritiker können ja schlecht sagen, dass die Moratoriumsentscheidung falsch ist.
Im Schatten der japanischen Katastrophe hat sich ein anderes weltpolitisches Ereignis vollzogen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag unter anderem eine Flugverbotszone über Libyen beschlossen. Warum wehren Sie sich so vehement dagegen?
Wir wollen den Diktator stoppen. Deswegen standen wir bei den Sanktionen von Anfang an an der Spitze der internationalen und europäischen Bewegung. Aber militärische Einsätze und Luftschläge sind etwas anderes. Ich will nicht, dass wir auf eine schiefe Ebene geraten, an deren Ende dann deutsche Soldaten Teil eines Kriegs in Libyen sind.
Macht man sich durch Nichtstun nicht genauso schuldig wie durch militärisches Eingreifen?
Die Alternative zu Militäreinsätzen ist doch nicht Nichtstun. Wenn man einen Militäreinsatz mit all seinen Unwägbarkeiten bis zum Ende denkt, womöglich bis zum Einsatz von Bodentruppen und einer jahrelangen Präsenz, dann komme ich zu dem Ergebnis: Nein, wir werden uns mit deutschen Soldaten nicht beteiligen, so ehrenwert auch die Motive unserer Partner sind, die sich anders entschieden haben.
Deutschland hat sich im Sicherheitsrat als einziges westliches Land der Stimme enthalten, genauso wie demokratisch eher weniger gefestigte Länder wie Russland und China. Ist das die Gesellschaft, in der wir uns wohlfühlen sollten?
Vergessen Sie bitte Brasilien und Indien nicht. Wir haben uns enthalten, weil wir bei einem gewichtigen Teil der Resolution – militärischem Eingreifen – nicht mitmachen werden. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Ihr ist ein schwieriger Abwägungsprozess voraus gegangen. Ich bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war.
Sie haben es als persönlichen Erfolg verbucht, dass Deutschland in den Sicherheitsrat gewählt worden ist. Jetzt enthalten wir uns in einer zentralen Frage der internationalen Politik. Ist die weltpolitische Bühne zu groß für uns?
Mit 7.000 Soldaten der Bundeswehr, die derzeit in Auslandseinsätzen tätig sind, nimmt Deutschland seine internationale Verantwortung wahr. Wir sind drittgrößter Geber von Entwicklungshilfe. Unser Engagement für Frieden und Freiheit wird weltweit anerkannt.
Die Arabische Liga hat eine Flugverbotszone gefordert. Mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollen sich wohl zwei arabische Länder an der Durchsetzung beteiligen. Damit sind die Bedingungen erfüllt, die sie selbst aufgestellt haben. Warum wollen Sie nicht zumindest an Awacs-Aufklärungsflügen beim Kampf gegen Muammar al-Gaddafi teilnehmen?
Wir werden uns mit deutschen Soldaten am militärischen Eingreifen in Libyen nicht beteiligen. Ich wiederhole: Wir haben das sehr gründlich erwogen und eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Die gilt. Wie die Staaten der Region sich konkret verhalten, werden wir sehen. Ich beobachte, dass ausgerechnet diejenigen in Deutschland jetzt rufen „Rein nach Libyen!“, die sonst rufen „Raus aus Afghanistan!“
Es geht erst mal nur um eine Flugverbotszone. Niemand will doch Bodentruppen nach Libyen schicken.
Die Resolution hat Luftschläge autorisiert. Und eine No-Fly-Zone ist kein verkehrrechtliches Regelwerk, sondern ein militärischer Eingriff, zum Beispiel durch die Zerstörung von Luftabwehrstellungen. Ich sehe mich in einer Tradition der Zurückhaltung, was militärische Einsätze angeht. Das Wichtigste ist jetzt der Schutz der Menschen, die humanitäre Aufgabe. Wir müssen den Aufständischen die Möglichkeit geben, in Sicherheit leben zu können. Gaddafi muss weg – ohne Frage. Und ich wünsche mir, dass meine Sorgen bezüglich der Militäreinsätze unberechtigt sind.
Wie wollen Sie das erreichen? Gaddafi lacht über die Sanktionen.
Die Sanktionspolitik ist noch nicht ausgeschöpft. Sie kann und muss noch verschärft werden. Deswegen haben wir als erste entsprechende Initiativen vorgeschlagen. Ich erinnere mich gut, wie es dabei anfangs auch Vorbehalte bei einigen Verbündeten gab. Aber erstaunlich vieles wurde in der Zwischenzeit durchgesetzt: die Befassung des Internationalen Strafgerichtshofs mit dem Diktator, die Reiseverbote für ihn und seinen Clan, das Waffenembargo, die Sperrung von Geldflüssen. Es muss alles getan werden, dass Gaddafi nicht mehr an frisches Geld herankommt, um neue Söldnertruppen anzuwerben – auch keine Geldzuflüsse durch weitere Verkäufe von Erdöl.
Sie haben versucht, die National Oil Corporation (NOC) Libyens auf die schwarze Liste zu setzen. Das ist in der EU bisher nicht gelungen, vor allem Italien wehrt sich.
Die Resolution 1973 listet die NOC. Dies bedeutet eine Konteneinfrierung, die jetzt schnell umgesetzt werden muss. Wir gehen damit gezielt gegen die Ölindustrie vor.
Aber ist die Sanktionspolitik auch glaubwürdig? Saif al-Islam, einer der Söhne Gaddafis, hat noch vor kurzem ganz kaltblütig gesagt: Sie werden schon sehen: der Westen wird wieder Schlange stehen für unser Öl und Gas, wir kennen dieses Spiel. Und sein Vater hat den Russen und Chinesen große Lieferungen zugesichert, offensichtlich in der festen Überzeugung, die Weltgemeinschaft spalten zu können.
Das ist ihm ja nicht gelungen. Man muss auch Gaddafis erweitertem Umfeld klar machen, dass es für die internationale Gemeinschaft kein Zurück gibt zur Zusammenarbeit mit dem Diktator. Deshalb haben wir uns für eine Befassung durch den Internationalen Strafgerichtshof eingesetzt.
Wobei in Libyen eine verzweifelte Opposition händeringend die Weltgemeinschaft um Hilfe gebeten hat. Könnte der Effekt, wenn der Westen nichts tut, nicht gerade anders herum sein: Ihr gratuliert uns dazu, wenn wir Freiheit fordern und uns gegen die Diktatoren erheben, aber wenn es darauf ankommt, lasst ihr uns allein?
Es ist verständlich, dass die Aufständischen um Unterstützung gerufen haben. Aber wieso hat der Westen die primäre Verantwortung, und nicht die Staaten der Region, die Arabische Liga vor allem? Wir Deutsche haben im Übrigen schon Gespräche mit der libyschen Opposition geführt.
Was war Ihr Eindruck?
Westerwelle: Wir haben sie unserer Sympathie versichert, aber auch die Frage gestellt, ob ihnen eine Stammesgesellschaft vorschwebt oder eine demokratische Gesellschaft mit fairen, freien Wahlen. Das sind berechtigte Fragen.
Halten Sie es für verwunderlich, dass unter einem so repressiven System bislang keine lupenreinen demokratischen Führer heranwachsen konnten?
Das ist verständlich, da haben Sie recht. Und dennoch unterstützen wir als Demokraten die demokratische Entwicklung. Ich sehe mit großem Respekt, was in Libyen passiert, welche Risiken die Menschen bei dem libyschen Aufstand eingehen, und ich sorge mich mit den Menschen. Übrigens auch mit denen, die im Jemen, Bahrain, Iran, der Elfenbeinküste und vielen anderen Ländern, die heute nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, für ihre Freiheit eintreten.
Täuscht der Eindruck, dass der so hoffnungsvoll begonnene demokratische Aufbruch in der gesamten nahöstlichen Region ins Stocken geraten ist, der arabische Frühling sich einer neuen Eiszeit gegenübersieht?
Was vor zehn Wochen mit der Jasmin-Revolution in Tunesien begonnen hat, ist eine großartige Sache mit viel mehr Chancen als Risiken. Ich habe vor drei Wochen auf dem Tahrir-Platz, dem „Platz der Befreiung“ in Kairo gestanden. Es war ein beeindruckendes, bewegendes Erlebnis, als die Menschen jubelten und „Freiheit“ riefen und immer wieder die deutsch-ägyptische Freundschaft hochleben ließen. Der Tahrir-Platz ist jetzt für die Menschen ein völlig anderer Ort, so wie für uns Deutsche das Brandenburger Tor 1990 zu einem anderen Bauwerk, zu einem Symbol der Freiheit wurde.
Sie haben andererseits den mittlerweile gestürzten ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak noch im vergangenen Jahr als „Mann von enormer Erfahrung und großer Weisheit“ bezeichnet. War der Westen zu leichtgläubig gegenüber arabischen Diktatoren?
Damals ging es um die Frage, ob die Nahost-Friedensgespräche wieder aufgenommen werden. Wir waren über Jahre dankbar dafür, dass die ägyptische Regierung gegenüber Israel eine konstruktive Rolle gespielt hat. Darauf bezog sich meine Einschätzung. Ich setze darauf, dass diese konstruktive Rolle dann auch unter einer demokratischen Regierung fortgeführt wird.
Diese Hoffnung wird in Israel nicht geteilt.
Es gibt dort große Unruhe, das ist richtig. Ich versuche meinen israelischen Gesprächspartnern zu sagen, dass gerade jetzt die Zeit ist, einen neuen Anlauf zum Frieden zu starten. Da gibt es aus unserer Sicht nur einen überzeugenden Weg, das ist die Zwei-Staaten-Lösung. Deswegen rufen wir nicht nur die palästinensische Seite auf, keine Gewalt gegen Israel anzuwenden. Wir haben auch mit unserer Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen deutlich gemacht, dass wir die Wiederaufnahme des Siedlungsbaus durch die israelische Regierung ablehnen.
Sie haben Ägypten einen wichtigen Partner im Nahost-Prozess genannt. Das galt auch für Saudi-Arabien. Würden Sie das immer noch so sagen, nachdem gepanzerte Fahrzeuge aus Saudi-Arabien ins benachbarte kleine Königreich Bahrain gerollt sind, um dabei zu helfen, den dortigen Volksaufstand zu unterdrücken?
In Bahrain gibt es eine schiitische Mehrheit, die von einer sunnitischen Minderheit regiert wird. Das ist ein Konflikt, der nur in einem nationalen Dialog gelöst werden kann und nicht durch das Ausland.
Die Empörung im Westen über das saudi-arabische Vorgehen war sehr leise, auch von Ihnen war keine klare Kritik zu hören, geschweige denn Empörung. Saudi-Arabien wird mit Samthandschuhen angefasst, weil es einfach zu wichtig ist. Messen wir nicht nach wie vor mit zweierlei Maß?
Ich habe in beiden Regierungserklärungen in dieser Woche zu Bahrain klare Worte gefunden. Und auch bei meinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien habe ich beim Thema Religions- und Meinungsfreiheit kein Blatt vor den Mund genommen. Ich kann Ihnen versichern, dass das nicht zu einer Verschlechterung unserer Beziehung geführt hat.
Sie haben die Ereignisse im Nahen Osten mit dem Zerfall des Ostblocks im Jahr 1989 verglichen. Wenn man nach Libyen, Bahrain oder Jemen sieht, sieht es allerdings so aus, als könne es auch wie im Prager Frühling enden.
Der Ausgang der Geschichte steht noch nicht fest. Da haben Sie leider recht. 1989 gab es nicht nur die friedliche Revolution in Leipzig, es gab auch die Gewalt auf dem Tiananmen-Platz in Peking. Ich habe nie gesagt, dass es schon klar ist, dass die Geschichte ein Happy End nehmen wird. Aber ich sehe in der Entwicklung in der arabischen Welt eine große Chance, die man sich vor ganz kurzer Zeit nicht hat vorstellen können. Außerdem ist die Entwicklung der Freiheit in Mitteleuropa auch nicht monolithisch und ohne Rückschläge gewesen.
Herr Außenminister, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Copyright DER SPIEGEL, Ausgabe 12/2011