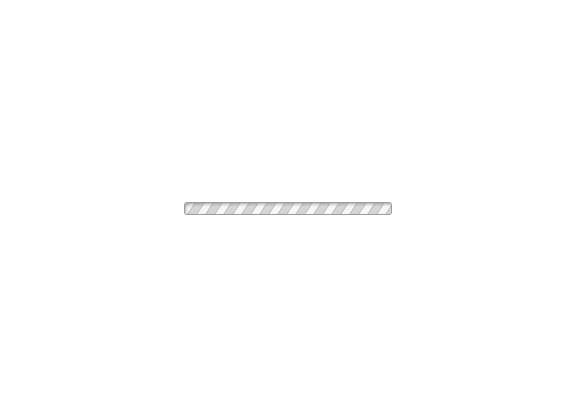Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Europa und der Blick von Außen“ - Rede von Bundesaußenminister Steinmeier zur Veranstaltung „Perspektive Europa“ in der Akademie der Künste zu Berlin
Bundesaußenminister Steinmeier hat am Freitag Abend (01.06) gemeinsam mit dem Präsidenten der Akademie der Künste, Klaus Staeck, die Konferenz „Perspektive Europa“ eröffnet und sich am Samstag mit einem eigenen Redebeitrag an der Konferenz beteiligt. Während der zweitägigen Konferenz, die vom Auswärtigen Amt und der Akademie der Künste im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft veranstaltet wurde, diskutierten, lasen und erzählten zehn große europäische und außereuropäische Vertreter aus Kunst, Kultur und Literatur von und über Europa. Teilnehmer waren unter anderem die Literaturnobelpreisträger Wole Soyinka und Imre Kertész, die Schriftstellerin Assia Djebar sowie der Schauspieler Mario Adorf.
Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Klaus,
Exzellenzen,
sehr verehrte Assia Djebar,
sehr verehrter Wang Hui,
sehr verehrter Elias Koury,
sehr verehrter Wole Soyinka,
liebe Frau Maischberger,
meine Damen und Herren,
„Wo die Idee Europa, wo Europäer und europäisch für gesicherte Begriffe gehalten werden, da liegt entweder eine Banalität des Geistes vor oder man glaubt, rasch zu praktischen Gesprächen kommen zu müssen.“ Ich gebe zu: Das könnte der Satz eines heutigen, im Dienste der europäischen Idee grau gewordenen Politikers sein.
Aber weit gefehlt! Es ist, fast wörtlich zitiert, Hugo von Hoffmannsthals Warnung vor der Illusion eines ein für alle mal definierten Europas - vor über hundert Jahren!
Und heute? Einen Augenblick lang darf man staunen, wie aktuell die Warnung auch heute noch klingt.
Ist inzwischen so wenig passiert? Im Gegenteil, werden Sie sagen - und ich widerspreche nicht: es ist sehr viel passiert, Europa ist eine in jeder Hinsicht realere Größe geworden als zu Hoffmannsthals Zeiten. Aber nicht, weil Begriff und Definition heute so viel sicherer wären, sondern weil wir das Vertrauen entwickelt haben, mit Begriffen leben und arbeiten zu können, die täglich neu überprüft werden müssen.
Wir beginnen deswegen heute einen Gedankenaustausch, der sich der Forderung nach unmittelbar praxisbezogenen Entschlüssen nicht unterwerfen muss, und auch die Banalität des Geistes hat heute und hier kein Bleiberecht: Die Akademie der Künste ist genau der richtige Ort, um die Politik und ihre kritischen Begleiter zusammenzuführen, die Autoren und Kulturschaffenden im weitesten Sinn.
Politikern fällt es mitunter schwer, den Abstand zwischen Kultur und politischer Praxis zu respektieren, aber dieser Abstand wird und muss weiter bestehen - dass die Kunst grundsätzlich die Freiheit vom Diktat aktueller Themen braucht, ist verständlich und verteidigenswert. Das muss aber weder Zurückhaltung noch politische Enthaltsamkeit bedeuten. Ganz und gar nichts ist gegen Künstler und Autoren einzuwenden, die zu aktuellen Fragestellungen des Gemeinwesens Stellung nehmen, weil sie die „res publica“ doch auch als ihre Sache betrachten. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie um so mehr, als gerade Imre Kertesz uns gestern daran erinnert hat, dass die Tragödie des 20. Jahrhunderts begann, als Politik und Kultur zu Feinden wurden!
Dass wir nicht nur als Politiker, sondern generell als Europäer in unserer Selbstwahrnehmung blinde Stellen haben, wissen wir, und genau deshalb wollen wir diesen Austausch. Gespräche beginnen oft als Verständigungsversuch zwischen Innen und Außen, zwischen Moral und Praxis, Interessenvertretung und Idealismus. Aber mit etwas Glück und Beharrlichkeit durchbrechen sie die vorgegebenen Schranken und öffnen sich für globale Verantwortung und für das gemeinsame Suchen nach einem guten Weg.
Aufgabe der auswärtigen Kulturpolitik, vielleicht sogar von Kulturpolitik überhaupt, in jedem Fall die Aufgabe der Außenpolitik ist es, gerade dasjenige kreative Potential zu schützen und zu fördern, welches in den Differenzen liegt. Wir können für Frieden, Stabilität und Wohlergehen besser sorgen, wenn wir Unterschiedlichkeiten nicht als Unglück, sondern als Chance betrachten.
Wir müssen nicht alles gutheißen, was andere sagen, aber wir sollten zu verstehen versuchen. Weil aber das Verstehen nicht immer leicht zu haben ist, sollten wir wenigstens das tun, was Grundvoraussetzung für Verstehen ist: den anderen achten und - ihn fragen!
Das sind keine ganz abstrakten Überlegungen, wie man meinen könnte. Denken wir an die Diskussionen der letzten Tage und Wochen zwischen Europa und Russland. Ohne Respekt für die nationale Überlieferung und die geschichtlich bedingten Traumata, ohne den Blick auf diese tieferen Schichten in jedem Gespräch können wir solche Diskussionen nicht verantwortungsvoll führen.
Imre Kertész hat gestern in seinem bewegenden Vortrag von den „Schulen der Bitterkeit“ berichtet, die die mittel- und osteuropäischen Völker durchlitten haben, und vom Wideraufreißen uralter nationaler Wunden. Das geichzeitig der tiefere Grund, warum ich mich angesichts der rasant eskalierenden Auseinandersetzung zwischen Estland und Russland sehr für eine Beruhigung der Situation engagiert habe - weil die Geschichte Deutschlands mit der Russlands, der baltischen Staaten und vieler anderer europäischer Staaten eng und seit dem letzten Jahrhundert über die Tragödie von Krieg und Verfolgung verknüpft ist, und weil ich auch ganz persönlich als deutscher Außenminister meinen Gesprächspartnern nicht nur mit Wissen um diese Geschichte, sondern mit Respekt vor ihren Traditionen und ihrer Kultur begegnen kann und will.
Denn, um es mit den Worten Milan Kunderas zu sagen: „Alle Nationen Europas erleben dasselbe gemeinsame Schicksal, aber jede Nation erlebt es aufgrund ihrer jeweiligen Erfahrungen anders.“ Und gerade deshalb gibt es für mich keine Alternative zu einem anspruchsvollen Dialog. Das bleibt unsere Aufgabe auch dort, wo Ergebnisse auf sich warten lassen. Sprachlosigkeit oder gar die Verweigerung von Dialog vertieft die Konflikte. Es gibt in der wechselvollen Geschichte der internationalen Beziehungen nur allzu viele Belege dafür.
Das gilt nicht nur in Europa. Auf allen meinen Reisen habe ich diese Erfahrung gemacht. Die Vermutung, dass wir wohl nie restlos verstehen werden, eint uns mehr als sie trennt. Dann nämlich, wenn überhaupt ein Bewusstsein von der Kreativität der Verschiedenheit existiert. Wir können ein solches Bewusstsein bestimmt nicht allein, und bestimmt nicht allein durch politische Gespräche herstellen.
Sondern wir brauchen hierzu die kulturelle Begegnung, die dieses Potential sinnlich erfahrbar macht, weil sich da die Köpfe und Herzen der Menschen am unmittelbarsten erreichen. Und unsere Aufgabe als Politiker ist es, hierfür Raum, ausdrücklich: Räume zur Verfügung zu stellen. Räume, in denen wir uns als Teil des alten Europa erklären, im besten Sinne des Wortes „verständlich“ machen. Und das über die ganze Bandbreite unserer politischen und kulturellen Ausdrucksformen!
Das heißt ganz praktisch: in unsere kulturelle Infrastruktur im Ausland zu investieren. Behutsam, aber nachdrücklich gehen wir deshalb seit meinem Amtsantritt an eine Neuaufstellung unserer Kulturpräsenz im Ausland. Dazu gehört auch Erhalt, Reform und wo immer möglich Ausbau unseres kulturellen „Flaggschiffes“, der Goethe-Institute. Ab dem nächsten Jahr wird ein weiterer Schwerpunkt hinzu kommen: Bildung. Unsere Auslandsschulen sind ein zu oft vergessenes Juwel! Wir werden sie stärken und mit einem neuen Element der Begegnungsschulen kombinieren, mit denen wir auch dort präsenter werden, wo wir es bisher nicht sind. Verbunden mit unseren Finanzhilfen für den jeweils landeseigenen Ausbau von Schulsystemen in Afrika und Asien soll das ein Beitrag sein zur interkulturellen Lerngemeinschaft, die wir dringend brauchen.
Und das sage ich auch ganz bewusst im Blick auf die Lage in Afghanistan: Was Europa und Deutschland und viele andere dort humanitär und kulturell an Aufbauarbeit leisten, darf weder entwertet noch aufgegeben werden. Und wer jemals die jungen afghanischen Mädchen und Jungs gesehen hat, die dank unseres Engagements wieder in Schulen für ein zivilisiertes Leben lernen können, der kann ermessen, was es bedeuten würde, diese Menschen im Stich zu lassen.
Kultur bietet die beste Möglichkeit zu begreifen, was uns ergreift. Und ob in den zahlreichen Gesprächen mit Schülern und Studenten auf meinen Reisen, ob in der Diskussion, zuletzt mit Marco Kreuzpaintner in Mexiko, der in Mexiko selbst als deutscher Regisseur einen amerikanischen Film über die Folgen der Globalisierung gedreht hat, oder in der berührenden Dichterlesung von Daniel Kehlmann auf meiner ersten Südamerika-Reise: Es begegnen sich da immer auch unterschiedliche Vorstellungen vom richtigen Leben. Und auch die Künstler und Kunstwerke treffen auf ungewohnte Deutungs- und Bedeutungszusammenhänge, manchmal sogar auf Missverständnisse oder Unverständnis. An fruchtbarem Austausch hat das nie gehindert. Und wir sollten alles dafür tun, solche kulturelle Wahlmöglichkeiten zu erhalten und zu vergrößern. Ich habe das bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse unter Bezug auf Amartya Sen deutlich gemacht, und Carlos Fuentes hat gestern noch einmal eindrücklich darauf hingewiesen: Eine die anderen ausschließende Identität sperrt uns in ein kulturelles Gefängnis. Und Sie merken, das führt uns unweigerlich zu der ganz hochpolitischen Frage nach der Berechtigung und Rolle von Leitkulturen.
Ich persönlich glaube: Unsere Aufgabe ist es, vor der Verschiedenheit keine Angst zu haben und uns nicht gegen Menschen aus anderen Kulturen abzuschotten. Sondern wir sollten zuhören, wenn möglich verstehen und uns anregen lassen von dem, was uns einleuchtet. Wir dürfen dabei selbstbewusst bleiben, und wenn wir eine andere Lebenspraxis für uns selbst und innerhalb unserer Grenzen ablehnen müssen, dann tun wir das in Ruhe, ohne ein Drama daraus zu machen.
Wir haben in Europa viel Erfahrung mit Doktrinen, mit dem Anspruch auf den Besitz der absoluten Wahrheit, mit Rezepten zur angeblich endgültigen Erlösung des Menschen. Ich habe Respekt vor allen, die um das richtige Leben ringen, aber es gibt bekanntlich Gewissheiten, denen wir bescheiden und energisch den Rechtsstaat und das Prinzip demokratischer Freiheitsrechte entgegensetzen müssen - das weiß das alte Europa! Und die Freiheit der Kunst ist ausdrücklich mit gemeint.
Nun verheißen Freiheitsrechte keineswegs immer nur das reinste Glück für alle. Sie müssen manchmal nicht nur von Minderheiten, sondern auch von der Mehrheit der Gesellschaft regelrecht ausgehalten werden, nicht nur in Fällen von kränkender Herabsetzung oder exzessiv schlechtem Geschmack. Aber aufs Ganze gesehen bringt uns Toleranz weiter als das Gegenteil, solange wir nicht gerade deren entschlossenste Feinde tolerieren.
Neu ist dieses Credo eines Europäers nicht. Ganze Generationen haben im Lauf der Jahrhunderte darum gekämpft, es zu geltendem Recht werden zu lassen, und ihnen schulden wir Respekt.
Aber nun sage ich als Außenpolitiker: Wir Europäer, und vielleicht der ganze sogenannte Westen, haben uns sehr daran gewöhnt, dass unsere Gewohnheiten und Denkweisen allerorts für richtig und vernünftig befunden und übernommen werden. Sie sind es nicht immer ganz von selbst. Wir müssen uns wieder angewöhnen zu überzeugen; geduldiger, nachhaltiger, vor allem widerspruchsfreier, als wir es manchmal tun. Unsere im letzten Jahrhundert dominierende ökonomische Hegemonie mit dem ihr inne wohnenden Drang nach gleichzeitiger kultureller Dominanz hat das etwas in Vergessenheit geraten lassen.
Der Wille, anderen Kulturen mit der notwendigen Empathie zu begegnen, ist weniger verbreitet als das Gegenteil. Obwohl auch die Offenheit für die Außenwelt, die Neugier auf andere Lebensweisen in der europäischen Kultur eine lange Tradition hat. Denken wir allein daran, wie viel Denkanstöße, wie viel Wertvolles aus Ostasien, aus Afrika oder Lateinamerika nach Europa vorgedrungen ist, wie viel Lebensweisheit, Kraftquellen und Erkenntnisse für den behutsameren Umgang mit uns und unserer Umwelt und für ein international und interkulturell vernetztes Denken. So, wie das Ilija Trojanow kürzlich formuliert hat: „Wenn wir uns für die Zukunft wappnen wollen, sollten wir unsere Grenzen als Zusammenflüsse begreifen. Denn das Trennende ist stets nur eine momentane Differenz, eine Flüchtigkeit der Geschichte.“
Dazu noch eine zweite außenpolitische Bemerkung, die im Grunde nicht nur außenpolitisch und dadurch hoffentlich umso glaubhafter ist: Wirkliche Sicherheit entsteht nur durch einen Dialog, in welchem wir Unterschiede sehen, aber nicht aufhören, das Gemeinsame zu suchen.
Sie entsteht nicht dadurch, dass wir den Dialog verweigern, etwa weil wir uns unserer Werte und Meinungen schon ganz sicher glauben. Wer das große Glück gehabt hat, sich ein unmittelbares Bild von der Welt zu machen, wer von der reichen Kultur Irans, von der Schönheit der arabischen Poesie auch nur eine Ahnung bekommen hat, wer die grandiosen Kulturdenkmäler entlang der Seidenstraße einfach einmal mit eigenen Augen gesehen hat, der wird nicht länger zu beweisen versuchen, dass die eigenen Traditionen notwendig ewiger seien als die der anderen, und der wird auch weniger häufig den Zeigefinger der Überlegenheit erheben.
Diese kulturelle Offenheit ist die Vorbedingung dafür, dass wir eine ohnehin gemeinsame Zukunft auf diesem Planeten auch gemeinsam gestalten.
Für die deutschen Zuhörer: Kultur gehört daher für mich auch nicht unter die Überschrift „Sicher leben“, wie das im Augenblick im Parteiprogramm einer großen deutschen Volkspartei zu finden ist, die - ich sage das zur Information - nicht die meine ist. Und, lassen Sie es mich so deutlich sagen, ich halte es für einen Irrweg, wenn geglaubt oder gefordert wird, „dass kulturelle Identität den Menschen in unserem Land Sicherheit bietet“.
„Kulturelle Sicherheit“, das scheint mir eher die Beschreibung eines der Albtraumes oder Angstzustandes zu sein, als eine zu Ende gedachte Erwartung.
„Kulturelle Offenheit“ ist dagegen das, was Resultat und Auftrag der europäischen Geschichte sein kann.
Schauen wir auf diese europäische Geschichte. Von Beginn an hat dieser Kontinent es sich und anderen schwer gemacht. Streit flammte auf zwischen Städten und Staatsformen seit der Antike, zwischen den Bekenntnissen, den Ländern und Regionen. Die Geschichte Europas ist vom Streit geprägt, und nicht jedes Mal hatte der Streit edle Motive. Immer wieder stellten sich die Europäer, und mit ihnen ihre Denker und Philosophen die Frage: Warum sind wir so, warum sind wir immer wieder ein Unglück für uns selbst und füreinander? Diese Frage hat die Nachdenklichen umgetrieben, und die gefundenen Antworten haben zu einem Prozess beigetragen, den wir „Aufklärung“ nennen und in diesem Zusammenhang noch zu etwas anderem: der Liebe zur Utopie. Seit jeher fantasierte man in Europa vom idealen Staat, von der idealen Gesellschaft. Oft vermutete man, dieses Utopia existiere irgendwo jenseits der Ozeane wirklich, manche Seefahrer behaupteten sogar, es entdeckt zu haben.
Und man hat versucht, die ideale Welt gewaltsam herbeizuführen, nur um dann zu sehen: das Glücksgefühl beim Aushecken von Simplifizierungen und Radikallösungen hielt nicht an, vor allem brachte es kein Glück. Die europäische Geschichte ist reich an Beispielen dafür, wie es nicht geht.
Europa hatte niemals und hat auch heute nicht auf jede Frage eine überzeugende Antwort, aber es hat - nach einer langen Geschichte eigener und fremder Leiden - ein paar Überzeugungen zu bieten.
Wir haben über Jahrhunderte europäischer Kriege, Bürgerkriege und Revolutionen die Erfahrung gemacht, dass ein wenig mehr Bereitschaft zur Ungewissheit uns gegen absolutistische Geltungsansprüche und gegen Totalitarismen immun macht. Nicht immer hat diese Auffassung gesiegt, oft ist sie gescheitert, und schrecklich viel Leid haben wir dabei erfahren.
Im Grund hat die Vernunft nie spektakulär gesiegt. Aber es fehlte zu ihr doch jede Vertrauen erweckende Alternative, also siegte sie doch. Wir haben durch den säkularen Rechtsstaat einen Rahmen geschaffen, der uns veränderbar und dennoch selbstbewusst bleiben lässt, wir müssen allerdings täglich daran arbeiten.
Peter Rühmkorf hat, in einer Sternstunde seiner großen Poesie, den Satz gefunden: „Bleib erschütterbar, - doch widersteh!“ Ich erlaube mir ungeniert, das als poetische Verdichtung eines sehr europäischen Credos zu nehmen.
Mit dem Blick auf fünfzig Jahre Alltag in der Europäischen Union füge ich hinzu: Wir widerstehen nicht dadurch, dass wir eine über jeden Zweifel erhabene europäische Homogenität und Identität postulieren. Unsere Einheit ist immer nur in der Vielfalt zu haben.
Blaise Pascal hat gesagt: Einheit ohne Vielfalt ist unnütz für andere, Vielfalt ohne Einheit ist schädlich für uns. So ist es, und das bedeutet, dass das Ringen, Verhandeln und Überzeugen kein Ende finden wird. Aber wir sind, soweit ich sehe, einigermaßen im Training, wo es darum geht, sachliche Gegensätze friedlich zu halten, Positionen darzustellen und ebenso freundlich wie hart miteinander zu verhandeln. Interessengegensätze gibt es innerhalb Europas ebenso wie außerhalb, unterschiedliche Ansichten über die Verteilung von Lasten, Kämpfe um Vorteile und selbstverständlich auch den Streit ums Geld. Da hat sich in Europa seit dem Peloponnesischen Krieg einiges, aber nicht alles geändert. Wir schaffen es aber, diese Gegensätze sachlich und friedlich zu halten, weil wir vermeiden, dass sie prinzipiell oder sogar pseudoreligiös überformt werden. Man soll zwar niemals nie sagen - irgendwelche Aufregungen werden immer wieder kommen, aber wir wissen immerhin, dass in der Ruhe die Kraft liegt.
Unser System hat Mängel, und es wirkt möglicherweise noch mangelhafter, als es ist. Weil es keine absoluten Wahrheiten oder unbedingte Einsichten bietet. Freiheit, Wohlergehen und Gerechtigkeit sind nie ein- für allemal gesichert. Wertkonflikte zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen dem Recht auf Teilhabe und der freien Entfaltung der Persönlichkeit, zwischen dem Achtungsanspruch der Religion und dem Geltungsanspruch der Gesetze sind in den europäischen Ländern durchaus verschieden geregelt und werden immer wieder neu justiert.
Aber eben hierin kann eine Stärke Europas in der Welt liegen. Wir stehen uns zwar häufiger selbst im Weg, aber wir haben gelernt damit zu leben. Wir wissen, wie das Sten Nadolny vor einem Jahr gesagt hat, „es gibt weder politische noch religiöse Wege, die sicher und unmittelbar ins Glück führen. Jeder eingeschlagene Weg muss regelmäßig überprüft und korrigiert werden, wenn er nicht zuverlässig ins Unglück führen soll“.
Solange wir das beherzigen, solange werden wir wohl doch nicht, wie viele drinnen und draußen befürchten, in Egoismus und Kommerzialisierung und in einer eindimensionalen Lebensweise versacken, denn nichts hindert uns daran, diese Gefahr zu sehen und im Auge zu behalten.
Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns weiter für den Erhalt der Substanz des europäischen Verfassungsvertrages einsetzen: Ich bezweifle nicht, dass er unvollkommen ist. Wie wir Europäer selbst. Aber ich sage auch: die darin gefundenen Kompromisse, die neuen Wege und Ziele sind mehr und besser als das, was wir jetzt haben!
Aber auch die europäische Verfassung, oder wie immer das Reformwerk heißen wird, wird nur eine Etappe auf dem Weg der europäischen Integration sein. Für unser darüber hinaus gehendes Bemühen brauchen wir den Blick von außen dringend, und darum freue ich mich auf die heutigen Diskussionen. Die Gäste und Zuhörer hier stehen stellvertretend für die Menschen in der Welt, die sich fragen: Wie geht es weiter? Wo liegen die Gefahren unseres Weges? Wie vergrößern wir die gemeinsamen Chancen? Und das sind auch unsere Fragen.
An die Künstler, die Schriftsteller und Intellektuellen richte ich nochmals die Bitte: Lassen Sie die Politik, vor allem aber die Bürgerinnen und Bürger nicht allein. Selbstverständlich werden Sie Ihre Kunst niemals der Diktatur des politischen Zeitgeistes, seiner Überschriften und medialen Ausdrucksformen unterordnen. Und wir hätten daran kein Interesse, denn nur die schon erwähnte Banalität des Geistes könnte das von Ihnen verlangen.
Im Gegenteil: Gerade weil Kunst und Literatur antizipieren, fingieren und ein herrliches Durcheinander anrichten können, deshalb brauchen wir Ihre Autonomie und hoffen auf Ihren unverwandten Blick. Gerade weil Sie Dinge sehen, herstellen, beschreiben können, an die der Realismus des Alltags nicht heranreicht, deshalb benötigt die Wirklichkeit Ihre Hilfe. Sehen Sie uns auch ruhig genauer bei der Arbeit zu oder, wie man sagt, auf die Finger.
Wobei ich versichere: Politik, das Schicksal des Gemeinwesens, auch des globalen, ist keineswegs ein so banales, abgekartetes Spiel, wie ein politikverdrossener Small-Talk oft glauben machen will.
Politik ist nicht nur die Routine der Geldverteilung, es wird keineswegs nur Macht verwaltet und erhalten. Entgegen mancher absichtsvollen medialen Verkürzung wird sehr wohl um Lösungen gerungen, für die Zukunft der eigenen Gesellschaft wie auch für Bedrohungen globaler Natur. Dass wir dabei auch immer wieder nach Mehrheiten suchen, sollte in einer Demokratie keine Empörung auslösen. Und wenn die aufwändige Suche nach Verständigung und Kompromiss, wie jetzt in der Klimaschutzpolitik, nicht sofort gelingt, delegitimiert das meiner Ansicht nach nicht das Bemühen darum. Das scheinen manche nicht zu verstehen, die sich inzwischen aus Routine gegen internationale Konferenzen wenden, weniger mit Blick auf die Themen und Inhalte. Kurz: Die Behauptung, in der Politik ginge es nicht um Politik, sollte kein wohlgefälliges Kopfnicken auslösen. Sie ist so richtig und so falsch wie die Behauptung, in der Wirtschaft gehe es nicht um Wirtschaft und im Journalismus nicht um Wahrheit.
Wer mir davon kein Wort glaubt, den möchte ich dringend einladen, genauer hinzusehen, oder jedenfalls nicht immer auf die gleiche Stelle - kurz: seinen Beobachtungsstandort für die „Perspektive Europa“ zu verändern.
Zum Schluss also auch heute meine Bitte, wie ich sie gestern Abend bereits geäußert habe: Lassen Sie uns teilhaben an Ihrer Sicht, an Ihrer Meinung und Ihrem Rat. Ich versichere Ihnen: Wir haben Sie eingeladen, weil wir zuhören wollen und weil wir auf Ihre Einsichten und Einfälle neugierigsind. Und last but not least, weil wir wissen, dass wir zu lernen haben. Das verbindet ohnehin alle hier ganz zuverlässig, darauf verzichten kann niemand.