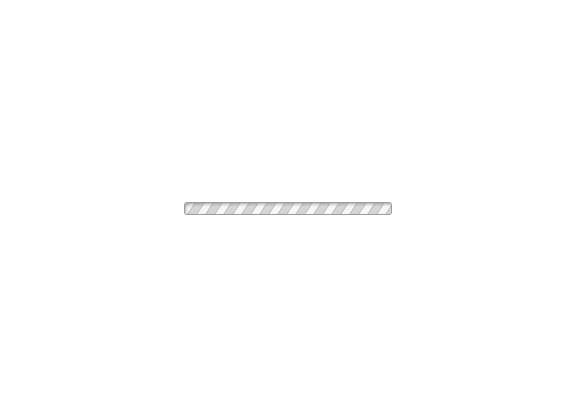Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der Tagung „Europäische Erinnerungskulturen“ im Weltsaal des Auswärtigen Amts
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
was Sie gerade gehört haben, klingt nach Zukunftsmusik. Ist es aber nicht. Im Gegenteil, das elektromagnetische Theremin, auf dem das deutsch-russischen Duo Lydia Kavina und Carolina Eyck gerade so virtuos gespielt hat, ist bald hundert Jahre alt. 1919, kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, erfand es der sowjetische Physiker Lew Thermen.
Eine passendere Einstimmung könnte ich mir kaum denken. Schließlich geht es auch uns heute Abend um die Gegenwart von Vergangenem in unseren verschiedenen europäischen Erinnerungskulturen – und darum, wie sie unser Denken und Handeln prägt.
Mit dem heutigen Abend setzen wir einen Schlussakkord des Gedenkjahrs 2014, in dem wir uns des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren erinnern. Wir beschließen unsere Tagungsreihe „1914 – 2014. Vom Scheitern und Nutzen der Diplomatie“, an der unter anderem Herfried Münkler, Christopher Clark, Gerd Krumeich, Kevin Rudd, Laurent Fabius, Michael Thumann, Adam Krzeminski und Igor Narskij mit viel Herzblut mitgewirkt haben – um nur einige zu nennen.
Wir schließen zugleich die zweitägige Expertenkonferenz „Europäische Erinnerungskulturen“ hier im Auswärtigen Amt. Liebe Frau Triebel, ich danke dem Institut für Auslandsbeziehungen herzlich für die Organisation. Lieber Professor Arendes, lieber Professor Wolfrum, der Universität Heidelberg danke ich für die wissenschaftliche Beratung.
*
Meine Damen und Herren, das Gedenkjahr mag zu Ende gehen. Aber die Vergangenheit bleibt gegenwärtig. Das hat uns das Jahr 2014 in aller Schärfe spüren lassen. Die Geschichte ist eben nicht 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs an ihr Ende gekommen. Von einem solchen „Ende der Geschichte“ mag mancher geträumt haben. So recht daran geglaubt haben wir wohl alle nie.
Spätestens die einschneidenden außenpolitischen Umbrüche dieses Jahres 2014 haben die These vom „Ende der Geschichte“ Makulatur werden lassen. Zugleich haben uns diese Umbrüche klarer als jeder Gedenktag oder jede Feierstunde vor Augen geführt, welche langen Schatten die europäische Geschichte bis heute wirft.
Wer hätte vor zwölf Monaten schon geglaubt, dass das Gedenkjahr 2014 selbst in die Geschichte unseres Kontinents eingehen würde? Wohl kaum jemand. Ich selbst habe zu Beginn unserer Tagungsreihe hier im Auswärtigen Amt vor fast genau einem Jahr gesagt: „Ein Krieg in Europa ist unvorstellbar gewesen.“ Und eher aus einer Ahnung heraus habe ich hinzugefügt: „Aber, meine Damen und Herren, das war er vor hundert Jahren auch schon einmal.“
Und doch ist es so gekommen. Nirgends ist das so deutlich geworden wie in der Krise in der Ukraine, die uns nun seit fast genau einem Jahr in Atem hält – und zwar unlösbar von einem vielschichtigen historischen Hintergrund.
*
Was in der Ukraine geschieht, wirft nicht zuletzt ein gleißendes Schlaglicht darauf, wie viel wir noch über unsere Nachbarn in Europa und ihre Erinnerungskulturen lernen müssen. Das gilt insbesondere für Russland. Denn ob als Freund oder Feind, als Partner oder als Gegner: Nachbar wird dieses Russland uns in doch jedem Fall bleiben. Aus diesem Gedanken heraus bin ich zuletzt vor einer Woche nach Jekaterinburg gereist, um den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.
Meine Damen und Herren, die Krise in der Ukraine zu stoppen, das erfordert zuallererst klares und auch hartes Handeln. Es verlangt Festigkeit in den Prinzipien und ein klares Urteil auch bei schwierigen Abwägungsprozessen.
Dazu gehört heute, dass wir unseren russischen Nachbarn mit aller gebotenen Bestimmtheit zu verstehen geben: Der Versuch, sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa Grenzen zu korrigieren – einseitig, ohne Achtung für staatliche Souveränität und nicht eingekleidet in die Prozesse der internationalen Gemeinschaft – so dürfen wir nicht miteinander umgehen!
Aber zur Wahrheit gehört eben auch: Einen Weg aus der Krise hinaus zu weisen, eine Krise gar friedlich zu lösen, das erfordert mehr. Dazu gehört eben auch die Fähigkeit, den Anderen zu verstehen und die Bereitschaft, sich mit seinem Blick auf die Geschichte auseinanderzusetzen.
Wohlgemerkt: Es geht nicht darum, das Handeln zu rechtfertigen, das der Andere aus seiner Interpretation der Geschichte ableitet. Aber es geht sehr wohl darum, nachzuvollziehen, was ihn treibt.
Seien wir ehrlich: Hier in Deutschland haben wir doch bis heute oft nur ein verschwommenes Bild davon, mit welchen Gefühlen die Menschen in der Ukraine und in Russland auf die Geschichte zurückblicken. Nehmen Sie nur den Ersten Weltkrieg:
Wer hierzulande kann schon einschätzen, welche weitreichenden Folgen die ukrainische Staatsbildung auf der Spitze deutscher Bajonette 1918 und die Niederlage dieses ersten ukrainischen Staats der Moderne gegen die Rote Armee wenig später hatten? Und haben wir wirklich verstanden, welche innerukrainischen Konflikte am Ende des Kriegs aufgebrochen sind, und wie sie wohl bis heute nachwirken?
Was wissen wir darüber, wie tiefgreifend Krieg und Revolution die russische Gesellschaft geprägt haben? Können wir nachfühlen, wie die Geschichte des untergegangenen Russischen Reichs heute in Moskau, Petersburg oder Jekaterinburg nachhallt, und wie sich mancher in Russland fragt, wie sich in der Welt des 21. Jahrhunderts an diese Vergangenheit anknüpfen lässt?
Um die Geschehnisse in der Ukraine richtig einzuordnen, müssen wir solche Fragen viel tiefer durchdringen als bisher. Der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, den wir am 8. Mail 2015 begehen werden, wird uns dazu im nächsten Jahr reichlich Gelegenheit geben.
Nur wenn wir verstehen, welche Lehren unsere Nachbarn aus der Vergangenheit ziehen, welche Träume und welche Traumata sie aus der Geschichte ableiten, dann gelingt uns der entscheidende Schritt – die Überwindung der Sprachlosigkeit.
Das ist nicht nur eine Angelegenheit für Historiker. Gerade wir Diplomaten sind darauf angewiesen. Wohin die Sprachlosigkeit der Diplomaten im schlimmsten Fall führen kann, das hat die Julikrise des Jahrs 1914 in aller Schärfe gezeigt. Als die Sprache versagte und als die Gesprächsfäden rissen, konnten die beiden Schüsse von Sarajewo die ganze Welt in den Abgrund stoßen.
Nein, Verstehen ist nicht Verständnis und erst recht nicht Einverständnis! Aber Verstehen ist die Voraussetzung für Verständigung, ohne die keine Beendigung eines Konflikts möglich ist. Es ist Grundbedingung für den kritischen Dialog, ohne den es keine friedliche Streitbeilegung gibt.
*
Meine Damen und Herren, gerade weil diese Aufgabe so enorm anspruchsvoll ist, bin ich froh, dass Sie für den Titel der heutigen Veranstaltung den Plural gewählt haben: „Erinnerungskulturen“, nicht „Erinnerungskultur“.
Im Singular wäre das eine ganz andere Konferenz geworden. So wichtig und bewegend die gemeinsamen Gedenkfeiern dieses Sommers auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs waren: Eine von allen geteilte Erinnerung an das 20. Jahrhundert kann und wird es auf dem europäischen Kontinent so bald nicht geben. Dazu haben unsere Vorfahren diese Geschichte zu verschieden erlebt, dazu prägt sie unsere Länder bis heute zu unterschiedlich.
Auch das ist in der Ukraine-Krise offenbar geworden. Denken Sie nur an die verschiedenen Perspektiven innerhalb der Europäischen Union, in Warschau, in Paris oder eben in Berlin. Unsere geschichtlichen Erfahrungen miteinander, mit Europa, mit Russland haben uns unterschiedlich geprägt. Der westliche Teil Deutschlands musste keine Erfahrung unter dem Joch der Sowjetunion machen – ganz anders sah es in Polen aus, und wieder anders in Frankreich.
Hier müssen wir sehr genau hinhören, welche geschichtlichen Echos bei unseren Nachbarn mitschwingen. Wir müssen nachvollziehen, vor welcher historischen Folie gerade unsere polnischen Nachbarn auf die Krise in der Ukraine blicken. Natürlich schlägt sich das in der Art und Weise nieder, wie wir Außenpolitik betreiben. Natürlich führt uns das immer wieder zu unterschiedlichen Bewertungen.
Entscheidend ist aber, was uns in der Europäischen Union trotzdem verbindet. Es ist der unbedingte Wille, ungeachtet unserer verschiedenen Erinnerungskulturen im Hier und Heute zusammenzustehen und gemeinsam zu handeln. Genau dieser Wille zur Gemeinsamkeit ist die innere Logik, der Herzschlag der Europäischen Union. Und diese Logik bewährt sich – auch im Härtetest der Ukraine-Krise. Wenn es einen ermutigenden Gedanken gibt, der sich aus dieser Krise ableiten lässt, dann ist es dieser.
Deshalb ist es weder wünschenswert noch notwendig, dass wir unsere verschiedenen Erinnerungskulturen zu einem künstlichen „Einheitsnarrativ“ einebnen. Entscheidend ist etwas ganz anderes: Die Offenheit, sich ohne falschen Relativismus darauf einzulassen, wie der Nachbar auf die Geschichte blickt. Der Respekt dafür, dass er aus dieser Geschichte andere Träume und andere Traumata herleitet als wir. Und die gemeinsame Bereitschaft, trotz unterschiedlichen Blicks auf die Vergangenheit gemeinsame Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu geben.
*
Meine Damen und Herren, eines sollten wir darüber nie vergessen. Die Geschichte Europas mag lange Schatten werfen. Sie mag uns hundert Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor schwierigste außenpolitische Aufgaben stellen. Aber es liegt doch in unserer Hand, diese Geschichte in die Zukunft weiterzuschreiben.
Diplomatie macht eben einen Unterschied, und zwar im Guten wie im Schlechten. Deshalb brauchen wir verantwortungsvolles Handeln und nüchternes Abwägen der Folgen. Wir brauchen die Werkzeuge und den Willen, Kompromisse auszuloten und Konflikte auszuräumen – all das, woran es am Vorabend des Ersten Weltkriegs fehlte.
Und so schwer diese Aufgabe manchmal ist – so sehr sollten wir als Geschichtsforscher wie als Außenpolitiker beherzigen, was mir vor einigen Tagen der israelische Historiker Menachem Ben Sasson zugerufen hat: „Die Geschichte wirft nicht nur Schatten auf die Gegenwart, sondern auch Licht.“