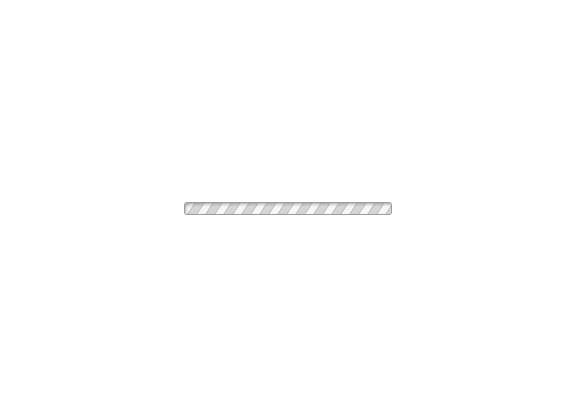Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Außenminister Steinmeier anlässlich der Verleihung der Lead Awards in Hamburg, 14. November 2014
--es gilt das gesprochene Wort--
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich sage Dank für die Einladung und habe Respekt vor dem Risiko, einen Politiker zur Lage der Medien reden zu lassen.
Wenn ich Journalist wäre, würde ich den Zustand der Verlags- und Medienbranche wahrscheinlich mit solchen Schlagzeilen beschreiben:
Small ist beautiful.
Voll auf die Presse – Journalismus in der Glaubwürdigkeitskrise
Vor dem Bildschirm ist es duster – Werden Journalisten die Bergleute des 21. Jahrhunderts?
Der letzte macht das Licht aus – Massenentlassungen erschüttern Deutschlands Redaktionen
Ich bin aber kein Journalist, sondern Politiker. Außerdem fehlt mir bekanntlich die Neigung zur missverständlichen Kürze. Aber die hilft auch nicht immer, wie wir aus unseren beiden, ganz unterschiedlichen Perspektiven wissen.
Unter Diplomaten erzählt man sich die Geschichte vom Botschafter in einem schwierigen Land, der daheim seinem Minister Bericht erstatten soll. Der Minister fragt: Wenn Sie die Lage in Ihrem Land in einem Wort zusammenfassen sollten, welches wäre das? Der Botschafter überlegt und sagt: Gut. Das hatte der Minister nicht erwartet, er hakt nach. Und was, wenn Sie die Lage in zwei Worten zusammenfassen sollten? Der Botschafter sagt: Nicht gut.
Nicht gut, dieser Befund beschreibt auch die Lage der Zeitungen und Zeitschriften. Als Demokrat sehe ich das mit einiger Sorge. Freie Medien, möglichst viele unterschiedliche freie Medien sind die Grundlage einer lebendigen Demokratie. Genauso wie andersherum Medien eine Demokratie brauchen, denn nur dann können Journalisten wirklich frei recherchieren und schreiben. Wenn Medien in die Krise geraten, kann das die demokratische Gesellschaft nicht kalt lassen.
Umso mehr, als die Printmedien zurzeit sogar in einer doppelten Krise stecken. Ihr Wirtschaftsmodell ist in Bedrängnis geraten, und gleichzeitig beginnt eine Debatte über ihren Deutungsanspruch und ihren Informationswert. Gestatten Sie mir ein paar Minuten, um dazu ein paar Anmerkungen zu machen, die über das Schema Gut/Nicht gut hinausgehen.
Als Außenminister benutze ich in meinen Reden gerne die Formulierung, die Welt sei aus den Fugen geraten. Nun stehe ich hier vor Ihnen, Chefredakteure, Verlagsmanager, Werbestrategen, und denke: Der Satz passt auch für Ihre Welt nicht schlecht.
Erstaunlich, wie schnell das ging. Vor 15 Jahren wimmelten die Anzeigenabteilungen mancher großen Tageszeitung Kunden ab, damit die Samstagsausgabe noch in den Briefschlitz passte. Neue Zeitungen wurden gegründet, Büros vergrößert. Der Markt brummte, und er schien alles zum Guten zu regeln, sogar die Qualität. Dann platzte die New Economy-Blase, PC und Laptop eroberten die Schreibtische und seitdem ging es bergab. In den vergangenen zehn Jahren halbierten sich die Werbeeinnahmen der Medienbranche, die Auflage schrumpfte um ein Drittel.
An uns liegt das übrigens nicht. Das Auswärtige Amt abonniert Zeitschriften und Zeitungen im Wert von über 150.000 Euro im Jahr, dafür bezieht es unter anderem 45 mal den SPIEGEL und 29 Exemplare der ZEIT, wir abonnieren die Süddeutsche 30 und die FAZ sogar 60 mal. Aber auch das Hamburger Abendblatt, die Märkische Allgemeine und die Werra Rundschau finden in meinem Ministerium täglich treue Leser. Einige 10.000 Euro jährlich überweist das Amt übrigens für die Erstellung von Pressespiegeln, was sich hoffentlich auch auf Ihre VG Wort-Ausschüttungen auswirkt.
Trotzdem: Den Trend kann man damit natürlich nicht stoppen, und der ist - nicht gut. Jahrzehntelang hatte die Medienwirtschaft hohe Erträge in einem Markt erzielt, der durch die Sprache von internationaler Konkurrenz abgeschottet war. Der Siegeszug des Internets hat der Presse nun eine Konkurrenz erwachsen lassen, die an der Wurzel des Geschäftsmodells ansetzt: der Werbung. Eine zeitlang wurde recht erfolgreich versucht, die schrumpfenden Werbeeinnahmen durch Preiserhöhungen auszugleichen. Aber das funktioniert nicht endlos, und wenn die Auflagen einbrechen, umso weniger. Das liegt wiederum auch daran, dass das Internet die Verbreitung werbefinanzierter Gratiskonkurrenz fördert, oft genug aus den eigenen Verlagen. Die Kerze, so sagt man wohl, brennt offenbar an beiden Seiten.
Für manches Krisenmanagement hätte sich die Branche die eine oder andere kritische Schlagzeile und Kommentierung sicherlich verdient. Wenn wir als Bundesregierung agieren würden wie so manches Verlagshaus, könnten wir uns jedenfalls auf einiges gefasst machen. Ein Verlag stößt Zeitungen ab, die eigentlich profitabel sind, der andere kauft wahllos dazu, wohl in der Hoffnung, ihm werde schon noch was Kluges dazu einfallen. Die eine Zeitung stärkt das Lokale, um Leser zu binden, die andere schließt Redaktionen in der Fläche, um Kosten zu sparen. Andere haben anscheinend den Kampf um die besten Lösungen vorübergehend eingestellt und konzentrieren ihre Kräfte auf interne Machtkämpfe. Chefredakteure werden fast so häufig gefeuert wie Trainer in der Bundesliga, wenn der Abstieg droht.
Die Ratlosigkeit der Branche wurde vielleicht von niemandem besser illustriert als von Donald Graham. Der Vorstandsvorsitzende der „Washington Post“ begründete den Verkauf seiner ehrwürdigen Zeitung an den Internet-Pionier Jeff Bezos mit dem Satz: „Das Zeitungsgeschäft hat nicht aufgehört, Fragen aufzuwerfen, auf die wir keine Antworten haben.“ Da hat man Armin Müller-Stahl vor Augen und spürt einen Hauch von Buddenbrooks, der Geschichte eines langsamen Abstiegs.
Werden die Journalisten zu den Bergleuten des 21. Jahrhunderts, wie ich eingangs in einer Schlagzeile formulierte? Als Journalisten haben Sie womöglich öfters mal über Strukturwandel geschrieben. Der Steinkohlebergbau ist in Deutschland fast verschwunden. Mein Vater arbeitete als Tischler in der ostwestfälischen Möbelindustrie, unzählige klein- und mittelständische Unternehmen, ich habe dort gejobbt. Heute ist sie bis auf die verbliebenen 10 Prozent verschwunden. Solche Prozesse haben Journalisten oft analysiert und beschrieben. Sind Sie jetzt davon betroffen?
Unglücklicherweise sind die Medien in diesem Existenzkampf noch von einer zweiten Krise betroffen. Es geht um nichts weniger als ihre Glaubwürdigkeit. Medienbashing ist in diesen Tagen zu einer Art Trendsportart geworden. Wer wie Eva Herman, Udo Ulfkotte oder Thilo Sarrazin über verlogene, korrupte oder gemeine Journalisten schimpft, verkauft viele Bücher. Wenn dagegen ein Korrespondent in Krisengebieten falsch recherchiert oder ein Kommentator eine unpopuläre These zuspitzt, kann er sich auf Beschimpfungen und Verschwörungstheorien in den sozialen Medien gefasst machen.
Das Zusammentreffen von Wirtschafts- und Glaubwürdigkeitskrise hat der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen kürzlich in der ZEIT so beschrieben: „Es besteht eine eigene Tragik darin, dass die pauschale Kritik die Qualitätsmedien in einem Moment trifft, in dem manche von ihnen um die Existenz kämpfen.“
Man kann das auch plastischer ausdrücken, etwa mit dem Satz des legendären Ruhrgebiets-Fußballers Jürgen „Kobra“ Wegmann: „Zuerst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu.“
Was sind die Ursachen der Glaubwürdigkeitskrise? Die einfachste Erklärung wäre: Der Leser ist schuld, der ist halt dumm und frech. Der kapiert nicht, wie gut die Zeitungen sind. Aber mit dem Leser ist es wie mit dem Wähler. Man kann sich über ihn ärgern, aber man sollte ihn nicht ignorieren und am besten sehr ernst nehmen.
Die zweite Möglichkeit: Die Umstände sind schuld. Das wäre in diesem Fall mal wieder das Internet. Es hat der Individualisierung unserer Gesellschaft einen zusätzlichen Schub gegeben. Engagierte Leser finden im Netz persönliche Informationskanäle, und sie können selbst Informationen und Meinungen produzieren, ohne Redaktion und Druckerpresse, einfach zu Hause per Computer und WLAN.
Damit hätte das Internet das Entstehen „einer fünften Gewalt“ begünstigt: dem Publikum. Das Zitat ist übrigens wieder von Pörksen, nicht von Jürgen „Kobra“ Wegmann. Die Leser schauen der vierten Gewalt der Medien bei der Arbeit über die Schulter und klopfen ihr manchmal feste auf die Finger.
Es gibt aber auch eine dritte mögliche Ursache für das Misstrauen: Vielleicht waren sich die Journalisten einfach ihres Deutungsmonopols zu sicher. Vielleicht haben sie ihr Herrschaftswissen zu lange vor sich hergetragen und nicht gemerkt, welche neue Form von Öffentlichkeit das Internet entstehen ließ. Vielleicht aber auch haben die täglichen Abrechnungen mit dummen, ignoranten Politikern in den Zeitungen das Interesse der Leser an Politik sinken lassen – und am politischen Journalismus gleich mit.
Das wäre fatal, auch für die Demokratie. Wir brauchen sie, die kritischen, fundierten, relevanten Berichte. Nur mit Texten und Recherchen, die durchdringen und nachwirken, kann die Presse ihrer Wächterrolle gerecht werden.
Was kann man tun, um aus dieser Krise zu kommen, hoffentlich stärker und klüger als zuvor? Mit Sparen allein wird das nicht gehen, auch wenn Sie in den nächsten Jahren gefordert sind, Ihre unternehmerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Wichtiger ist vielleicht noch, sich auf das Fundament Ihres Erfolgs zu besinnen: Qualität, Relevanz und Vielfalt. Setzen Sie die richtigen Prioritäten. Das heißt: Journalismus zuerst!
Vielfalt ist einer der Schlüssel für die Akzeptanz von Medien. Die Leser müssen das Gefühl haben, dass sie nicht einer einzelnen Meinung ausgesetzt sind. Reicht die Vielfalt in Deutschland aus? Wenn ich morgens manchmal durch den Pressespiegel meines Hauses blättere, habe ich das Gefühl: Der Meinungskorridor war schon mal breiter. Es gibt eine erstaunliche Homogenität in deutschen Redaktionen, wenn sie Informationen gewichten und einordnen. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch.
Das Meinungsspektrum draußen im Lande ist oft erheblich breiter. Wie viele Redakteure wollen Steuersenkungen, Auslandseinsätze, Sanktionen? Und wie viele Leser? Sie müssen nicht dem Leser nach dem Munde schreiben, genauso wenig wie wir Politiker nur auf Umfragen starren sollten. Aber Politiker und Journalisten gleichermaßen sollten die Bedürfnisse ihrer Leser und Wähler nicht dauerhaft außer acht lassen.
Als Leser und als Politiker wünsche ich mir klare Worte meiner Zeitung. Ihr Urteil sollte aber auch fundiert sein, und es sollte am besten noch ein erkennbar eigenes Urteil – und unterschieden von der Nachricht – sein. Ich will nicht den Eindruck haben, dass alle das Gleiche schreiben, das macht misstrauisch.
Ein eigenes Urteil erfordert eigene Erkenntnisse. Wir brauchen Journalisten, die sich Zeit nehmen und in eine Materie tief einsteigen. Dazu gehört auch ein Korrespondentennetz. Ich weiß, das ist teuer, und wahrscheinlich kostet ein erfahrener Korrespondent im Ausland so viel wie drei Nachwuchsleute in der Zentrale. Der SPIEGEL und der STERN haben in den vergangenen 15 Jahren die Zahl ihrer Auslandskorrespondenten halbiert, das eine Blatt verkleinert das Büro in Washington, das andere schließt Moskau ganz und so weiter, Sie kennen die Fakten besser als ich. Aber: Den Mangel an Präsenz und Ortskenntnis kann niemand auf Dauer durch Meinungsstärke ausgleichen.
Ich bezweifele, dass Sie sich und Ihren Lesern damit einen Gefallen tun. Korrespondenten vor Ort, die im täglichen Leben die Probleme ihres Gastlandes erspüren, sind auch in Zeiten des Internets nicht zu ersetzen. Schicken Sie nicht erst Reporter aus Hamburg oder Berlin in ein Land, wenn das Auswärtige Amt einen Krisenstab eingerichtet hat. Wer dann erst beginnt, wird die Komplexität von politischen, ökonomischen, kulturellen und religiösen Entstehungsgründen von Konflikten selten verstehen
Vielleicht denken Sie sich jetzt, ja als Außenminister muss man so reden. Die Leute interessiert das doch gar nicht. Sind Sie sich sicher? Ich glaube fest, dass mündige Bürger sich für differenzierte Berichterstattung interessieren und auch bezahlen. Aber sie spüren auch, wenn Journalisten selbst nicht glauben, dass ihr Stoff interessant genug ist und ihn deshalb mühsam aufbauschen und anschärfen.
Ich weiß, guter Journalismus kostet Geld. In jüngster Vergangenheit hat eine Debatte darüber begonnen, ob es nicht eine Art staatliche Stiftung zur Förderung des Qualitätsjournalismus geben sollte. Zunächst könnte man darüber ja scherzen. Da fürchten hochmögende Redakteure, die jahrzehntelang den freien Markt gepredigt haben, um ihre althergebrachte Frühstückslektüre. Die wird dann zum Weltkulturerbe erklärt, und der liberale Leserjournalist ruft nach Staatsknete.
Malen wir uns das doch mal kurz aus: Markus Peichl verwaltet mit der Lead Academy einen solchen öffentlich-rechtlichen Fördertopf. Staatssekretäre des Bundes und der Länder, die wegen der Zuständigkeit für Medien beteiligt wären, träfen sich jährlich im Verwaltungsrat. Natürlich würden sie ihre ganz eigene Meinung über Qualität und Seriosität vortragen.
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts würde vielleicht monieren, dass die „Welt“ nicht so seriös war, als sie über angebliche Lösegeldzahlungen bei einer Geiselnahme schrieb. Der Kollege aus dem Innenministerium würde Kolportagen aus der Welt des Verfassungsschutzes im SPIEGEL beklagen. Und der Staatskanzleichef einer Landesregierung würde fragen, ob die auffällige private Nutzung des Dienstwagens durch den Ministerpräsidenten unbedingt im Feuilleton der ZEIT aufgespießt werden müssen.
Spaß beiseite: Ich bin nicht pauschal gegen Förderideen, aber als Politiker möchte ich doch darauf hinweisen, dass manche Konstruktionen Politiker in die Versuchung führen könnten, die besseren Journalisten zu sein.
Und das sind wir nicht. Das sollte allerdings auch andersherum gelten. Demokratie und Medien können nur gemeinsam funktionieren, wenn die Distanz gewahrt wird. Denn nur die ermöglicht es, dass die Demokratie von kritischer Öffentlichkeit profitiert, und die Medien in Freiheit blühen.
Diese Distanz ist besser gewahrt, wenn auch Journalisten sich vor der Versuchung schützen, Politiker zu sein, wenn sie darauf verzichten, mit einer geschickten Kampagne mal ins Räderwerk der Demokratie zu greifen, und wenn sie auch davon absehen, andere, wirkliche Politiker so zu attackieren, als seien sie Konkurrenten. Das sind sie nicht. Politiker sind keine Journalisten, und Journalisten keine Politiker.
Politiker zu sein ist ein toller Beruf, aber auch einer für Profis. Genauso wie Ihrer. Ihrer ist ein besonderer Beruf, ohne den unser Gemeinwesen ärmer wäre und unsere Demokratie verfiele. Tun Sie alles, damit Journalisten weiterhin gute Arbeit leisten können. Die Medienwirtschaft ist keine Branche wie jede andere. Deshalb hoffe und vertraue ich darauf, dass Sie die aktuellen Krisen meistern. Wir brauchen Sie!
Vielen Dank!