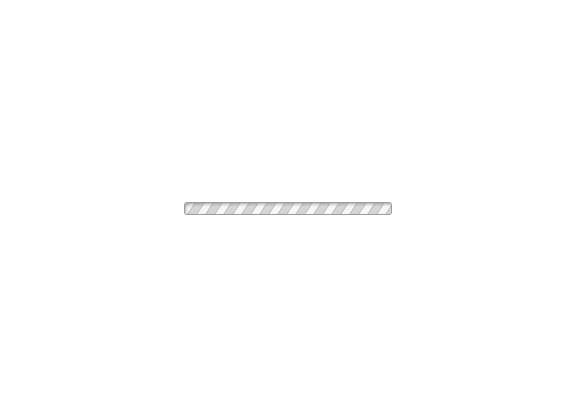Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Aus der Krise lernen – Perspektiven einer Reform der EU“ - Rede des Staatsministers für Europa Michael Roth anlässlich des Forums Constitutionis Europae an der Humboldt-Universität zu Berlin am 14. Oktober 2014
-- es gilt das gesprochene Wort --
Danke für die Gelegenheit, heute meine Gedanken zu Europa mit Ihnen teilen zu dürfen. So wie Sie, liebe Studierende, habe ich als Student auch einmal in einem Hörsaal bei Professor Pernice gesessen. Und es hat mir nicht geschadet!
Damit Sie besser verstehen, was mich antreibt, warum ich seit nunmehr 16 Jahren als Parlamentarier und seit fast einem Jahr als Staatsminister im Auswärtigen Amt für ein vereintes und friedliches Europa kämpfe, blicken wir kurz auf das Jahr 1989 zurück. Vor genau 25 Jahren sollte ich eigentlich für das Abitur büffeln. Meine Welt war damals noch eine völlig andere als heute. Enge statt Weite. Zonenrandgebiet eben. Ich bin in Nordosthessen, nicht mal einen Kilometer Luftlinie von der Grenze zur damaligen DDR aufgewachsen, sozusagen als einer der östlichsten „Wessis“. Ich blickte auf Mauer, Zaun und Selbstschussanlagen. Für uns alle war lange Zeit unvorstellbar, dass sich an dieser buchstäblich in Beton gegossenen Realität jemals etwas ändern würde.
Doch 1989 tat sich etwas um uns herum. Als ich von den Montagsdemonstrationen in Leipzig, vom Runden Tisch in Polen und den ersten Löchern im Eisernen Vorhang an der ungarisch-österreichischen Grenze erfuhr, spürte ich: In Europa wird gerade Geschichte geschrieben! Mein Abitur spielte plötzlich eine untergeordnete Rolle. Als im November 1989 die Mauer endlich fiel, brach sich die Freiheit ihre Bahn. Ein einziger Freudentaumel zog sich durch Deutschland und verbreitete Aufbruchstimmung auf dem ganzen Kontinent.
Das geeinte Europa ist die emanzipatorische Kraft, die aus Wünschen, Träumen und Hoffnungen gelebte Wirklichkeit werden lässt. Ja, es stimmt: Wir leben heute in Europa Tag für Tag unseren Traum von Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Wahr ist aber auch: Verwirklichte Träume neigen dazu, im Alltag schnell banal und selbstverständlich zu werden. Diese Erfahrung hat fast jeder schon einmal gemacht. Europa: Das ist heute für Viele wie eine in die Jahre gekommene Liebe. Die Euphorie lässt nach, dafür rücken die Probleme des Alltags stärker in den Blick. Es beginnt zu kriseln in der Beziehung, die Zweifel wachsen.
Doch Europas Strahlkraft droht auch noch aus einem anderen Grund zu verblassen. Das Modell Europa steht mittlerweile in einem knallharten internationalen Wettbewerb mit anderen gesellschaftspolitischen Konzepten. Die Marke Europa ist mitnichten ein Selbstläufer – sie muss sich Tag für Tag aufs Neue beweisen. Zwischenzeitlich versprechen auch andere Marken wirtschaftlichen Erfolg und Sicherheit – aber eben ohne die für Europa so charakteristische Verknüpfung mit Freiheit, Demokratie und Solidarität. Diesem globalen Wettbewerb müssen wir uns selbstbewusst stellen – und unsere Markenzeichen bewahren und verteidigen.
Lieber Herr Professor Pernice,
Sie haben mich gebeten, mit meiner Rede Begeisterung für Europa zu wecken. Zugegebenermaßen musste auch ich überlegen, wann ich zuletzt so richtig begeistert war. Ich reise viel durch Europa, treffe Woche für Woche auf engagierte Europäerinnen und Europäer. Aber ein Moment ist mir aus den vergangenen Monaten ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Im Sommer durfte ich in Flensburg an der feierlichen Ausrufung der Europa-Universität mitwirken. Dort trug der Poetry Slammer Björn Högsdal „sein“ Europa vor: Eine humor- wie gefühlvolle Hommage an das wunderbare Privileg, in und durch Europa seinen individuellen Lebensentwurf verwirklichen zu können.
Das war einer dieser besonderen Momente, wo ich gespürt habe: Europa vermag es eben doch zu begeistern und unsere Herzen zu bewegen – wenn wir uns nur darauf einlassen. Das kann man nicht in einem Lehrbuch nachlesen, sondern nur persönlich erleben. Wer einmal in einer WG in Lissabon gewohnt hat, eine Fahrradtour quer durch das Baltikum gewagt oder in einem Forschungsprojekt mit finnischen Kollegen zusammengearbeitet hat, der weiß, was ich meine.
Was unserem Europa bisweilen fehlt, ist die Empathie und die Leidenschaft. Davon brauchen wir viel mehr! Europa – das ist eben nicht nur eine Spielwiese für detailverliebte Technokraten. Europa – das ist nicht der Wahn der Gleichmacherei, der Uniformität, der Einebnung der Unterschiede. Im Gegenteil: Europa ist der Traum von Vielfalt, der Garant unserer individuellen Lebensentwürfe, unsere Lebensversicherung in den stürmischen Zeiten der Globalisierung! Das sollten wir uns viel öfter vor Augen führen, wenn wir wieder mal am Sinn und Wert Europas zweifeln.
Ich werde hier heute keine Regierungserklärung halten. Heute spricht nicht nur der Staatsminister zu Ihnen, sondern vor allem der Bürger Europas und überzeugte Parlamentarier Michael Roth.
Wir sind hier am renommierten Lehrstuhl für europäisches Verfassungsrecht. Dennoch will ich mit Ihnen heute keine juristische Diskussion führen. Wir brauchen derzeit vor allem eine Verständigung auf politische Ziele! Wohin wollen wir eigentlich mit der Europäischen Union? Diesen klaren europapolitischen Kompass habe ich in den Jahren der Krise bisweilen vermisst, als wir in Europa allzu oft auf Sicht gefahren sind.
Meine Kritik richtet sich aber nicht nur an die Politik. Wo bleibt denn die große intellektuelle Debatte über Europas Zukunft? Wo stecken die kreativen Köpfe und kritischen Geister in Kultur und Wissenschaft, die Europa den Spiegel vorhalten und uns zu neuen Taten anspornen? Europa braucht immer wieder den großen konzeptionellen Wurf. Doch was wir seit einigen Jahren erleben, sind Kleinkrämerei und ermüdende Debatten über Renationalisierung.
Wie wird der Kontinent aussehen, auf dem Sie, liebe Studierende, im Jahr 2030 leben? Lassen Sie mich diese kleine Zeitreise mit Ihnen wagen: Meine Vision ist ein Europa, in dem alle Mitgliedstaaten den Euro als gemeinsame, starke Währung eingeführt haben. Ein Ort, an dem wir stabiles Wachstum und Beschäftigung und damit Wohlstand und soziale Sicherheit für alle geschaffen haben. Sie werden dann schon seit einigen Jahren mitten im Berufsleben stehen und von den offenen Grenzen, einem echten europaweiten Arbeitsmarkt profitieren. Ich wünsche mir ein Europa mit einer modernen und zukunftsgewandten Wirtschaft. Ein Europa, das beispielgebend für die Welt ist beim Klima- und Umweltschutz. Ein Europa, das weltoffen ist und zugewanderten Menschen eine wirkliche Chance zur Integration eröffnet. Ein Europa, in dem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundwerte weiter auf allerhöchstem Niveau gesichert sind. Ein Europa, das seine außen- und sicherheitspolitischen Interessen mit einer Stimme in der Welt vertritt – mit einem gemeinsamen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und einer europäischen Armee.
Von manchem sind wir derzeit noch sehr weit entfernt. Aber es ist wichtig, dass wir uns ambitionierte Ziele stecken. Wir müssen dabei aber auch achtsam sein. Wenn wir nämlich Erwartungen wecken, die wir nicht zu erfüllen vermögen, dann wenden sich die Menschen enttäuscht von Europa ab. Die Europawahlen haben das eindrücklich gezeigt und sollten für uns alle ein Weckruf gewesen sein.
Ein Beispiel für ein besonders drängendes Problem: Die EU wird die dramatisch hohe Jugendarbeitslosigkeit nicht alleine in den Griff bekommen können – schließlich liegt die Zuständigkeit für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik weiterhin bei den Mitgliedstaaten. Deswegen müssen wir die Ziele immer als gemeinsame Aufgabe verstehen – zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, zwischen den verschiedenen Ebenen europäischen Regierens.
Um es ganz deutlich zu sagen: Die Debatte über die Rückabwicklung von Kompetenzen und die Abgabe von Souveränität führt aus meiner Sicht in eine Sackgasse. Natürlich soll die EU nicht alles bis ins kleinste Detail regeln. Der Begriff der „nationalen Souveränität“ ist in einer immer stärker globalisierten Welt jedoch immer öfter nur noch eine Illusion. Denn: Man kann doch nur das verlieren, was man tatsächlich noch besitzt. Wir können nicht an Kompetenzen festhalten, die wir faktisch längst verloren haben. Das scheinen einige noch nicht begriffen zu haben, die lauthals nach „weniger Europa“ rufen.
Wenn es darum geht, das Klima zu schützen, die Finanzmärkte zu regulieren, internationale Handelsströme zu steuern, oder effektiv, aber vor allem solidarisch und menschenwürdig, internationalen Flüchtlingsströmen zu begegnen – dann gelingt dies nur durch gemeinsames europäisches Handeln! Denn gerade bei diesen globalen Fragen stoßen die Nationalstaaten alter Prägung – im wahrsten Sinne des Wortes – an ihre Grenzen.
Der schwedische Schriftsteller Richard Swartz hat es kürzlich so formuliert: „Europa besteht aus zwei Kategorien von Staaten: die Kleinen und die, die immer noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind. Nur gemeinsam werden sie größer werden können, als sie tatsächlich sind.“
In der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts kann selbst das vermeintlich so große Deutschland seine Interessen nur in und über Europa wahrnehmen und durchsetzen. Im globalen Maßstab sind wir alleine ein ziemlicher Zwerg! Nur ein geeintes Europa bietet uns die Chance, die Globalisierung in unserem Sinne zu gestalten und verlorene Handlungsfähigkeit und Gestaltungsmacht zurückzugewinnen.
Um Ihnen an einem aktuellen Beispiel aufzuzeigen, wo ich mir mehr Mut und Selbstbewusstsein erhoffe: Nicht jede Kritik an dem transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP ist unberechtigt. Aber ich werbe dafür, dass wir Europäer die Verhandlungen mit den USA selbstbewusst führen. Es erstaunt mich, wenn manche Kritiker in ihren Sonntagsreden zwar laut nach strikten Regeln für die Globalisierung rufen. Beim ersten Versuch, mit dem Mutterland der Globalisierung über genau diese Regeln zu verhandeln, verlässt sie dann aber der Mut. Das ist doch absurd!
Der enorme Handlungsdruck der Krise hat uns vor Augen geführt, wo es in Europa immer noch hakt. Allzu oft dauern Entscheidungsprozesse zu lang und für viele Probleme fehlen der EU schlichtweg die geeigneten Instrumente. Wer das ändern und die politische Union Europas weiterentwickeln will, steht vor dem Dilemma, dass eine umfassende Vertragsänderung derzeit keine Chance auf Erfolg hätte.
Daher gilt es, die bestehenden Möglichkeiten der EU-Verträge intelligent auszuschöpfen und mehr Mut für pragmatische Lösungen zu zeigen. Eine immer größer und heterogener werdende EU ist mit Regeln des Konsenses und der Einstimmigkeit kaum noch handlungsfähig. Wenn wir nicht länger hinnehmen wollen, dass die integrationsunwilligsten EU-Partner das Tempo bestimmen, dann muss künftig bei immer mehr Projekten eine mutige Avantgarde voranschreiten. Machen wir uns nichts vor: Die differenzierte Integration ist längst Realität in der EU – denken wir nur an die Eurozone oder den Schengen-Raum. Und trotz allem Gerede von einer drohenden Spaltung der EU bin ich überzeugt: Ein Europa der Tempomacher ist immer noch um Längen besser als ein Europa des Stillstands!
Mehr Mut zu differenzierter Integration bedeutet mitnichten die Abkehr von der Gemeinschaftsmethode, die die Europäische Union in den vergangenen Jahrzehnten getragen hat. Wir müssen uns klar machen: Die Alternativen lauten doch nicht differenzierte Integration oder Gemeinschaftsmethode, sondern es geht darum, ob wir mehr Flexibilität im Rahmen der EU-Verträge wagen oder auf intergouvernementale Lösungen setzen wollen. Wir sollten uns darauf besinnen, was die Gemeinschaftsmethode eigentlich im Kern bedeutet: nämlich die Bereitschaft, sich – in letzter Konsequenz – auch von einer Mehrheit überstimmen zu lassen. Gemeinschaftsmethode bedeutet aber nicht, dass alle immer derselben Meinung und zum selben Zeitpunkt bereit sein müssen, denselben Weg einzuschlagen. Insofern sehe ich keinen unüberwindbaren Widerspruch zwischen beiden Wegen.
Die Instrumente der differenzierten Integration sind in den EU-Verträgen angelegt – sie sind also kein Tabubruch, sondern gewollte Politik. Sie bieten den Vorteil, dass die Gemeinschaftsinstitutionen stets eingebunden sind und die Verfahren und Handlungsinstrumente der EU genutzt werden können.
Zunehmend macht sich in Europa Verunsicherung breit, wie weit wir uns noch aufeinander verlassen können. Ja, wir haben in den zurückliegenden Jahren Solidarität geübt, um die Krise zu bewältigen. Gleichzeitig sind die Folgen der Krise stark in den einzelnen Mitgliedstaaten zu spüren. Entsolidarisierung schafft Raum für Populisten, Nationalisten und Anti-Europäer. Diese stellen den inneren Zusammenhalt unserer Gemeinschaft grundlegend in Frage.
Zu Recht fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, warum sie die Zeche für eine Krise zahlen sollen, die sie nicht zu verantworten haben, während die Finanzmarktakteure kaum an den Kosten beteiligt werden. Sie fragen sich auch, warum die EU zulässt, dass sich einige Mitgliedstaaten durch Steuer- und Sozialdumping unfaire Wettbewerbsvorteile verschaffen. Es ist schwer erträglich, dass sich Unternehmen wie Google und Apple in Irland niederlassen und dort für ihre europäischen Geschäfte praktisch keine Steuern zahlen! Das ist mit unserem Verständnis von innereuropäischer Solidarität und sozialer Gerechtigkeit unvereinbar.
Die drohende soziale Spaltung führt uns in konkreten Zahlen eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung vor Augen: Während Armut in Skandinavien praktisch kein Problem darstellt, sind in Rumänien oder Bulgarien mehr als 40 Prozent der Menschen von ihr betroffen. Chancengleichheit sieht anders aus!
Die Bewältigung der Krise hat tiefe Spuren hinterlassen. Viele Bürgerinnen und Bürger, das erlebe ich immer wieder auf meinen Reisen, fühlen sich erschöpft und überfordert vom Reformkurs. Diese persönlichen Begegnungen mit den Verlierern der Krise setzen mir immer wieder aufs Neue zu. Auch wenn wir über nackte Zahlen wie Haushaltsdefizite, Leistungsbilanzungleichgewichte oder makroökonomische Kennziffern sprechen, geht es doch immer um Menschen und ihre Schicksale.
Ja, es gibt erste positive Signale, die uns Mut machen. Viele der betroffenen Mitgliedstaaten haben den Weg notwendiger Strukturreformen mutig ergriffen. Doch der Weg ist noch sehr steinig, und vor allem verlangt er den Menschen in den krisengeschüttelten Staaten auch weiterhin große Opfer ab. Wir können jedoch weitere Anstrengungen nicht einfach ohne Rücksicht auf innenpolitische Entwicklungen durchsetzen.
Während in Deutschland die Wahrnehmung vorherrscht, man sei der Zahlmeister Europas, fühlt sich der Süden vielfach bevormundet. Lassen Sie uns diese ideologisch aufgeladene Debatte zwischen Konsolidierung und Wachstum endlich überwinden. Wir brauchen Strukturreformen, die Rückkehr zu soliden Finanzen, aber eben auch Investitionen und die Bewahrung des Sozialstaats – diese Elemente dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber sie brauchen eine neue Balance.
Dafür muss sich Europa künftig noch viel stärker als soziales Korrektiv verstehen. Es wurden Wachstumsinitiativen, Investitionsprogramme und eine Jugendbeschäftigungsinitiative auf den Weg gebracht. Bei der Umsetzung mangelt es hingegen noch an der nötigen Entschlossenheit. Ein Mehr an sozialer Sicherheit verspricht am Ende auch mehr Stabilität.
Deshalb brauchen wir vor allem in der Eurozone eine verbindlichere wirtschafts- ,sozial- und steuerpolitische Zusammenarbeit. Die Mitglieder der Währungsunion sind mittlerweile so eng miteinander verbunden, dass es unmittelbare Auswirkungen auf die anderen hat, was und wie ein Mitgliedstaat in Steuerfragen, der Wirtschaftspolitik, der Arbeitsmarktpolitik und auch der Sozialpolitik entscheidet.
Neben diesen wechselseitigen Abhängigkeiten ist es auch die Frage nach der sozialen Legitimation unserer gemeinsamen Währung, die uns zu grundlegenden Reformen zwingt. Bürgerinnen und Bürger akzeptieren eine Währungsunion nur dann, wenn sie wirtschaftliche und soziale Stabilität garantiert.
Die Krise hat diese Konstruktionsfehler der Eurozone schonungslos offengelegt. Eine einheitliche Geldpolitik und die Koordinierung der Haushaltspolitik allein reichen nicht aus. Die Währungsunion muss den Sprung zu einer echten Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialunion schaffen. Der Euro kann nur bestehen, wenn die Mitgliedstaaten auch ihre Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitiken verbindlicher abstimmen. Und ich rede hier nicht von Harmonisierung und blinder Gleichmacherei. Wir brauchen in der Eurozone beispielsweise Korridore für Steuern sowie qualitative Mindeststandards für die Gesundheitsversorgung, die Altersvorsorge sowie das Bildungs- und Betreuungssystem.
Der derzeitige Unterbietungswettbewerb im Steuerbereich ist unfair und unvereinbar mit einer echten Wirtschafts- und Währungsunion. Die grundlegende Reform der Unternehmensbesteuerung duldet keinen weiteren Aufschub. Eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer ist der erste Schritt, ein Mindeststeuersatz für Unternehmen der zweite.
Wenn ich mich frage, in was für einem Europa ich leben will, dann will ich mich nicht mit quantitativen Kennziffern zufrieden geben. Wir brauchen qualitative Ziele! Das Ziel einer Beschäftigungsquote von 75 Prozent ist lobenswert, aber wir brauchen Beschäftigung, von der es sich auch leben lässt. Außerdem wünsche ich mir ein Europa, in dem der Zugang zu Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und sozialen Sicherungssystemen allen offen steht. All das gründet auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse – ob in Masuren, Sizilien oder Schottland.
Auch in Deutschland haben wir Hausaufgaben zu erledigen: Bei den Bildungschancen sind wir wahrlich nicht an der Spitze! Immer noch hängt der Zugang zu weiterführender Bildung immens stark vom Geldbeutel der Eltern, und eben nicht nur vom eigenen Können ab. Auch an anderen Stellen haben wir in Deutschland durchaus noch Luft nach oben: Ich denke beispielsweise an die Bekämpfung des Niedriglohnsektors und prekärer Beschäftigungsverhältnisse oder an noch mehr Investitionen in Infrastruktur, Kitas, Schulen und Hochschulen. Das wird nicht nur Deutschland, sondern auch Europa voranbringen.
So wie der soziale Zusammenhalt als Hoffnungsversprechen zur EU gehört, machen uns im Inneren unsere gemeinsamen europäischen Werte stark. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, kulturelle und religiöse Vielfalt, der Schutz von Minderheiten sowie Presse- und Meinungsfreiheit – diese Werte sind das Markenzeichen der EU, sie schweißen uns Europäerinnen und Europäer zusammen. Vielleicht haben wir im Zuge der Krise nicht immer deutlich genug gemacht: Die EU ist weit mehr ist als nur ein Binnenmarkt, sie ist vor allem eine einzigartige Wertegemeinschaft.
Es waren eben diese Werte, nach denen sich die Menschen in der DDR und in den mittel- und osteuropäischen Staaten vor nunmehr 25 Jahren sehnten. Und die Strahlkraft der europäischen Werte ist bis heute ungebrochen – das beweist uns der Blick auf unsere Nachbarschaft: Auf dem Maidan in Kiew weht die Europaflagge, weil man dort an Europas Werte glaubt. Flüchtlinge aus Afrika setzen ihr Leben aufs Spiel, weil sie in Europa auf ein menschenwürdiges Leben und auf Sicherheit vor Verfolgung hoffen.
Doch der Bestand dieser Werte ist in Europa keine Selbstverständlichkeit, sie müssen jeden Tag aufs Neue gepflegt und verteidigt werden. In der EU ist das klassische Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten aufgehoben. Im Gegenteil: Für mich gibt es sogar die Pflicht zur Einmischung! Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir unsere Werte konsequent einhalten und schnell reagieren, wenn sie in Bedrängnis geraten. Denn dabei geht es auch um unsere eigene Glaubwürdigkeit: Wir müssen diese Grundwerte nach innen uneingeschränkt vorleben, um sie nach außen von anderen einfordern zu können. Wir brauchen endlich allgemeine, objektive und verbindliche Standards und einen politischen Prozess für eine konsequente Beachtung der Grundwerte. Sie sind unverzichtbar für eine starke Werteunion, die auch Belastungen standhält.
Wenn denn der Satz stimmt, dass sich die Qualität des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats auch daran bemisst, wie er mit seinen Schwächsten umgeht, dann müssen wir in Europa endlich gemeinsame Antworten auf die Frage finden, wie wir menschenwürdig und solidarisch mit Migrantinnen und Migranten umgehen. Der aktuelle Zustrom an Flüchtlingen ist Ergebnis dramatischer Entwicklungen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Probleme in den Herkunftsstaaten – Bürgerkriege, Hunger, Armut, Chancenlosigkeit – werden wir nicht über das Asylrecht lösen können. Ebenso wenig können wir sie mit mehr Patrouillenbooten im Mittelmeer oder der Wiedereinführung von Grenzkontrollen bekämpfen.
Viel zu lange haben wir die Augen davor verschlossen, dass Europa ein Einwanderungskontinent ist. Es ist Zeit für ein radikales Umdenken in der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik: Das Dubliner Regime ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen endlich einen solidarischen Verteilungsschlüssel, der die Aufnahme von Flüchtlingen in den EU-Mitgliedstaaten entsprechend ihrer jeweiligen Größe, Wirtschaftskraft und Aufnahmekapazitäten regelt. Voraussetzung dafür ist, dass die vereinbarten europaweiten Regeln und humanitären Standards für die Asyl- und Flüchtlingspolitik von allen EU-Mitgliedstaaten auch tatsächlich durchgesetzt werden. Und natürlich ist Flüchtlingspolitik immer auch Außen- und Entwicklungspolitik – hier müssen wir Wege mit den Herkunfts- und den Transitländern suchen.
Brüssel sind eben nicht nur die anderen, wir alle tragen Verantwortung für das vereinte Europa! Das wird allzu oft vergessen. Viel bequemer ist es, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben, wenn man selbst nicht bereit ist, für Entscheidungen einzustehen. Auch Politikerinnen und Politiker neigen immer wieder dazu, die EU zum Sündenbock oder zum Feigenblatt zu machen. Das Gute kommt aus Berlin, Paris oder Warschau, das Schlechte hat die EU-Bürokratie in Brüssel zu verantworten. Dabei entscheiden die nationalen Hauptstädte in Brüssel fast immer mit. Deshalb ist es so wichtig, dass zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, zwischen den EU-Institutionen und den nationalen Parlamenten neues Vertrauen wächst. Die Gemeinschaftsmethode bedeutet eben auch, dass wir alle gemeinsam Verantwortung für Europa übernehmen.
Mein Herz schlägt für einen starken, lebendigen Parlamentarismus! Wir brauchen die öffentlichen Debatten im parlamentarischen Raum – um Akzeptanz und eine stabile demokratische Legitimation für europapolitische Entscheidungen zu schaffen.
Deutschland hat sich traditionell immer für eine Stärkung des Europäischen Parlaments eingesetzt. Europäische Demokratie ist undenkbar ohne das Europäische Parlament. Und deshalb verdient das Europäische Parlament endlich auch ein Initiativrecht im Gesetzgebungsverfahren! Neben einem starken Europäischen Parlament brauchen wir aber auch selbstbewusste und aktive nationale Parlamente. Kein Parlament in Europa erscheint mir stark genug, um die demokratische Legitimation europapolitischer Entscheidungen im Alleingang zu sichern. Solange die Gelder für Bürgschaften und Hilfspakete in erster Linie aus nationalen Steuermitteln zur Verfügung gestellt werden, kann die parlamentarische Legitimation nicht allein durch das Europäische Parlament wahrgenommen werden. So wenig derzeit die Europaparlamentarier den Rechtfertigungsdruck auf nationaler Ebene spüren, europäische Solidarität zu üben, so wenig haben nationale Abgeordnete bisweilen die europäische Dimension ihres (Nicht-)Handelns im Blick.
Ein „Europa der Parlamente“ kann nur gelingen, wenn die nationalen Parlamente und das Europäische Parlament an einem Strang ziehen. Joschka Fischer hat sich im Mai 2000 in seiner Humboldt-Rede für eine zweite Kammer bestehend aus Delegierten aus den nationalen Parlamenten ausgesprochen. Dieser Vorschlag überzeugt mich nicht. Besser wäre es, wenn Abgeordnete des Europäischen Parlaments und aus den nationalen Parlamenten gemeinsam parlamentarische Verantwortung übernehmen – insbesondere, wenn es um geteilte Zuständigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten und der EU geht. Die Parlamente in Brüssel und in den Mitgliedstaaten sind keine Gegner, sondern Partner auf Augenhöhe.
Und noch etwas muss sich ändern: Bislang sagen die nationalen Parlamente eher, was sie nicht von der EU geregelt wissen wollen – umgekehrt wäre es viel besser! Bei der Subsidiaritätskontrolle zeigen die nationalen Parlamente gelbe Karten, wenn die EU-Kommission ihre Kompetenzen überschreitet. Noch haben wir es nicht in ausreichendem Maße geschafft, den nationalen Parlamenten eine eigene konstruktive, gestaltende Rolle zu geben. Die nationalen Parlamente sind nicht die Gesetzgeber des europäischen Sekundärrechts. Aber vielleicht wäre es ein Weg, ihnen das Recht zu geben, die EU-Kommission zu einer Gesetzesinitiative anzuregen – ähnlich dem Instrument der Europäischen Bürgerinitiative. Mitmachen ist jedenfalls besser als nur daneben zu stehen!
Und gerade weil ich Sie für Europa begeistern möchte, komme ich nicht umhin, Ihnen auch etwas zuzumuten. Für mich ist Europa immer auch eine Frage der inneren Haltung!
Die Zukunft Europas entscheidet sich nicht nur dort, wo Haushalte konsolidiert und Strukturreformen angepackt werden müssen. Wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir die Verantwortung für die Gestaltung Europas nicht allzu leichtfertig auf diejenigen abschieben, die derzeit eine schwere Krise durchmachen. Unsere europäische Zukunft entscheidet sich zu einem ganz wesentlichen Teil hier auf unseren Marktplätzen, in unseren Schulen, in unseren Universitäten und vor allem in unseren Herzen und Köpfen. Ihre Haltung, liebe Studierende, entscheidet ganz wesentlich darüber, ob wir uns eine rückwärtsgewandte Debatte der Ressentiments aufzwingen lassen, oder ob wir bereit sind, die Zukunft Europas selbstbewusst in die Hand zu nehmen.
In einem Land, in dem achtzig Prozent der Menschen ein vereintes Europa wünschen und in dem zwei Drittel sagen, dass sie die Zukunft der EU positiv sehen, bin ich nicht bereit, mich auf Rückzugsgefechte einzulassen oder mir einreden zu lassen, die Deutschen seien europaskeptisch.
Ja, wir haben in den zurückliegenden Jahren in Europa Solidarität mit den Staaten geübt, die ihre Probleme alleine nicht in den Griff bekommen haben. In Deutschland sind jedoch einige der Auffassung, Solidarität sei nicht mehr als ein Geschenk, das gelegentlich generös gewährt werden könne. Dass gelungene Solidarität stets eine Zweibahnstraße ist, von der auch die Starken profitieren, bleibt dagegen unterbelichtet.
Es gibt nicht die Krise der anderen, es gibt nur unsere gemeinsame Krise in Europa! Kein anderes Land hat in den vergangenen Jahrzehnten so sehr vom Binnenmarkt, von Währungsunion und offenen Grenzen profitiert wie Deutschland. Als exportorientiertes Land ist das aber zugleich auch unsere Achillesferse. Warum fällt es dennoch so schwer, Solidarität gegenüber anderen zu zeigen? Stimmt vielleicht, was manche sagen, dass Deutschland am Ende immer für die Fehler der anderen zahlt? Letztlich profitieren wir von jedem Euro, den wir in den EU-Haushalt oder den Euro-Rettungsschirm einzahlen. Das lässt sich gar nicht beziffern. Es wäre schön, wenn endlich Schluss wäre mit der Mär vom deutschen Zahlmeister.
Brandgefährlich wird es dann, wenn sich bei unseren Partnern der Eindruck verstetigt, es kümmere uns nicht, was um uns herum geschieht. Ich weiß, dass dieser Eindruck häufig falsch ist, wenn wir bedenken, wieviel Deutschland aktiv einbringt. Aber in der Politik können Wahrnehmungen manchmal genauso real sein wie Tatsachen.
Unsere europäischen Partnerländer erwarten zu Recht, dass Deutschland als größter Mitgliedstaat gerade in Krisenzeiten mehr Führungsverantwortung in der EU und in der Welt übernimmt. Andererseits beobachten unsere Nachbarn sehr genau, ob Deutschland seine wirtschaftliche und politische Stärke allzu dominant ausspielt.
Es kommt sicher auch wesentlich auf Deutschland an, aber so richtig gut sind wir erst im Team. Wir Deutsche sind bekanntlich gute Mannschaftsspieler – im Team mit anderen europäischen „Stars“ wie Frankreich, Italien, Polen und Schweden. Wenn wir in Europa wirklich Großes vollbringen und unsere Nachbarschaft stabilisieren wollen, dann schaffen wir das nur gemeinsam. Die EU darf niemals nur eine Angelegenheit der großen Mitgliedstaaten sein. In Europa kommt es weniger auf die Größe eines Landes an. Was zählt, sind vielmehr die Kreativität und die Ideen, mit denen sich ein Land in die europäischen Diskussionen einbringt.
Deshalb möchte ich Ihnen Eines besonders ans Herz legen: Sie stehen mitten in Ihrer Ausbildung und noch am Anfang Ihrer beruflichen Karriere. Die Europäische Union wird Ihr Umfeld und Ihr Leben in den nächsten Jahrzehnten noch viel stärker prägen, als dies für die vorherige Generation der Fall war.
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die Europa Ihnen bietet! Und vor allem: Reden Sie mit! Als junge Bürgerinnen und Bürger liegt es an Ihnen, das Europa von morgen und übermorgen mitzugestalten. Es liegt in Ihren Händen und Köpfen, Europa eine Richtung zu geben.
Aber gehen Sie dabei nicht den leichten Weg von grauer Theorie und vorgefertigten Meinungen. Gehen Sie den langen, manchmal schwierigeren Weg und erweitern Sie Ihren Horizont nicht nur im übertragenen, sondern im tatsächlichen Sinne. Bilden Sie sich selbst Ihre Meinung von Europa!
Ich hoffe, Ihnen dafür heute einige Denkanstöße gegeben zu haben. Und damit zumindest diese eine Frage nicht unbeantwortet bleibt: Mein Abitur habe ich dann doch noch geschafft! Mein Weg führte mich vom Zonenrandgebiet ins vereinte Europa.