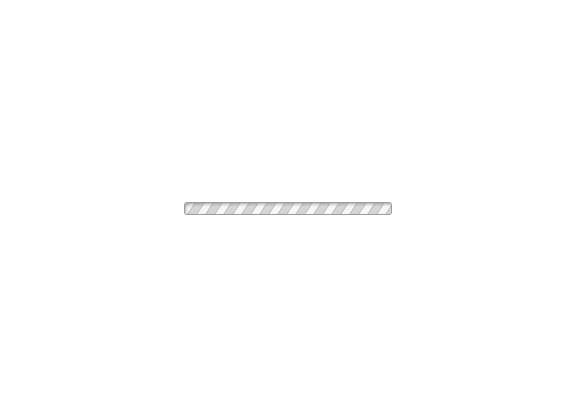Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Es wird zu Recht von uns erwartet, dass wir uns einmischen“
Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Interview zu den Grundzügen seiner Außenpolitik. Erschienen in der Süddeutschen Zeitung vom 30.01.2014.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Interview zu den Grundzügen seiner Außenpolitik. Erschienen in der Süddeutschen Zeitung vom 30.01.2014.
***
Herr Steinmeier, Sie sind nach vier Jahren zurück im Ministerbüro. Was hat sich geändert?
Das Arbeitszimmer ist dasselbe, die Welt ist es nicht. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich da weitermachen kann, wo ich vor vier Jahren aufgehört habe. Denken Sie nur an Syrien, den Nahen und Mittleren Osten, die Krisenherde in Afrika oder Osteuropa. Die Krisen sind näher an die europäischen Grenzen herangerückt.
Das ist ja nicht neu. Neu ist der Ton, der aus der amtierenden Bundesregierung kommt. Da ist viel von Verantwortung und Engagement die Rede.
So richtig eine Politik militärischer Zurückhaltung ist, so darf sie nicht missverstanden werden als eine Philosophie des Heraushaltens. Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur zu kommentieren. Es geht um tätige Außenpolitik: Es wird zu Recht von uns erwartet, dass wir uns einmischen und mit unseren Möglichkeiten die Bearbeitung von Konflikten so frühzeitig wie möglich angehen.
Deutschland handelt – da rollen viele die Augen in Europa.
Führung wird gerne verlangt, aber dann doch nur schwer ertragen. Insofern rate ich uns, in Europa keine Hüte aufzusetzen, die mit der europäischen Wirklichkeit wenig zu tun haben. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns verstecken, sondern dass wir unseren Mehrwert gemeinsam mit den Europäern einbringen.
Wächst die Verantwortung mit der ökonomischen Stärke?
Innerhalb von Europa mag die Verschiebung der ökonomischen Gewichte zu mehr Einfluss Deutschlands geführt haben. Aber diese Sicht ist mir zu eurozentrisch. Die großen Konflikte sind näher an Europa herangerückt, ihre Folgen sind auch in Deutschland unmittelbarer zu spüren. Dazu kommt: Wir können nicht mehr wie früher darauf setzen, dass die Amerikaner die Konflikte für uns schon richten werden. Die USA haben ihr Interesse an Europa und der Welt nicht verloren. Aber Amerika kann und will nicht mehr überall sein. Das verlagert, ob wir das wollen oder nicht, die Verantwortung für Sicherheit in Europa mehr auf unsere Schultern.
Was heißt das für die Ultima ratio der Außenpolitik, den Einsatz von Militär?
Ich will der Frage nicht ausweichen: Keine Außenpolitik der Welt kann die Ultima ratio aus dem politischen Denken verbannen. Aber es ist auch sehr deutsch, dass wir die Qualität guter Außenpolitik immer nur an der Bereitschaft zu militärischem Handeln messen. Nach meiner festen Überzeugung wird viel zu wenig darüber nachgedacht, wie wir den Instrumentenkasten von Diplomatie angemessen ausstatten und einsetzen.
Ein Beispiel?
Libyen ist nach dem Militäreinsatz der Nato noch immer ein höchst fragiler Staat. Wie es mit Libyen weitergeht, hat große Auswirkungen auf ganz Nordafrika, übrigens auch auf uns in Europa. Waffen aus Libyen schaffen auch große Destabilisierungsgefahren für das Nachbarland Tunesien, das mutig um seine demokratische Zukunft ringt. Was tun wir? Wollen wir in Libyen Waffenlager räumen, sichern oder vernichten? Wie geht das am besten? Wie und mit wem können wir Informationsgewinnung, technischen Sachverstand und politische Kontakte nach Tripolis so bündeln, dass das auch funktioniert?
Eine Übersetzung für Ihre Arbeit insgesamt, bitte?
Sollten wir nicht erst einmal unser Denken über Außenpolitik infrage stellen? Liegt nicht ein Widerspruch darin, dass wir einen außenpolitischen Riesen wie Henry Kissinger auch in Deutschland ehren und auszeichnen für seine Bemühungen um einen Weg von friedlicher Koexistenz und Öffnung mit China und andererseits zur gleichen Zeit jede Form des Umgangs mit Staaten, die sich nicht an den Grundmustern westeuropäischer Ordnung orientieren, unter Generalverdacht stellen? Es geht überhaupt nicht darum, etwas unter den Tisch zu kehren. Im Gegenteil. Ich habe eher Sorge, dass wir uns in einen fortschreitenden Sprachverlust in den zwischenstaatlichen Beziehungen hineinbewegen. So würden menschliche Kontakte ausgedünnt und die Gefahr von Missverständnissen erhöht.
Kissinger ist eine umstrittene Person. Er zeigt: Die reine Lehre gibt es nicht in der Außenpolitik. Gefällt Ihnen das?
Ist das nur eine Lehre von Kissinger oder der Außenpolitik, dass es die reine Lehre nicht gibt? Es geht doch um weit mehr. Was er in Erinnerung ruft, ist die alte Erfahrung von Diplomatie, dass man gut daran tut, den Konflikt mit den Augen des anderen zu sehen, bevor man Position bezieht. Gerade in Europa haben wir einen Hang zu einer Außenpolitik des starken Statements. Wir sind schnell bei der Hand mit der Benotung von Ereignissen und Entwicklungen in irgendwelchen Teilen der Welt. Und zwar ohne uns wirklich klarzumachen, wo wir Möglichkeiten zur Einflussnahme haben. Viel wichtiger als die Debatte um Militärinterventionen ist aus meiner Sicht eine Verständigung darüber, welche politischen Instrumente, welche diplomatischen Hebel wir jenseits der öffentlichen Kommentierung haben, um wirklich auf den Gang der Dinge einzuwirken. Wo können wir uns früher einbringen, anstatt im zugespitzten Stadium nervös die Dinge zu bemeinen?
Geht es nur ums Kommentieren oder schon ums Moralisieren?
Da, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, müssen wir kritisieren und nach Abhilfe und Hilfsmöglichkeiten suchen. Und wir müssen uns für die mutigen Menschen einsetzen, die in ihren Ländern Missstände anprangern und ihr Recht auf Mitsprache und Mitbestimmung einfordern. Etwas anderes wäre mit unseren verfassungsrechtlichen und ethischen Pflichten nicht vereinbar. Aber Außenpolitik darf sich nicht in der Kritik solcher Zustände erschöpfen. Aus Kritik wird sonst bloße Empörungsrhetorik, der Weg in Abschottung und Sprachlosigkeit ist dann schnell gegangen. Mir fehlt hier und da ein Funken Realismus in unserem Blick auf die Welt. Was können wir beeinflussen, was nicht? Viele in Deutschland urteilen von hoher Warte herab und in der Gewissheit, dass man sich in außergewöhnlich stabilen, demokratischen, freien und prosperierenden Umständen befindet.
Syrien zeigt, dass Außenpolitik oft nur die Wahl zwischen Übeln lässt. Hierzulande gibt es dagegen oft eine absolute Erwartung: an Obama, an Putin, an Israel. Wo bleibt der Realismus angesichts des moralischen Drucks?
Eine kluge Außenpolitik ohne Realismus dreht notwendigerweise leer. Meine Generation ist im Antagonismus des Kalten Krieges groß geworden. Die Zweiteilung der Welt mit ihren zynischen Gewissheiten hat ein Freund-Feind-Denken gefördert. Die Zeit nach 1990 war dann auf einmal nicht mehr so eindeutig, Konflikte waren nicht mehr nur weltanschaulich motiviert, sondern ethnisch oder religiös aufgeladen. Diese neue Komplexität hat die Vermittlung von Außenpolitik schwerer gemacht, auch weil das klare Feindbild fehlt.
Die Öffentlichkeit verlangt aber nach Orientierung.
Orientierung ja, aber nicht entlang allzu einfacher und deshalb falscher Schwarz-Weiß-Kategorien. Feinderklärungen wie die „Achse des Bösen“ haben uns dem Weltfrieden nicht näher gebracht. Ich befürchte, andere Vereinfachungen, die Geschichte, Tradition und Religion ausblenden, helfen auch nicht weiter. Es geht überhaupt nicht um Rechtfertigung. Aber selbst wenn es uns nicht gefällt: Wir können nicht ignorieren, dass es Regionen auf der Welt gibt, die sich an anderen Prinzipien orientieren als denen der westlichen Demokratie. Dort erfordern Veränderungen Zeit.
Aha, also keine werteorientierte Außenpolitik mehr?
Wir fordern die Achtung der Menschenrechte ein. Die Einhaltung ist Teil der UN-Charta. Natürlich stehen wir an der Seite der Menschen, die gegen Unrecht und Unterdrückung kämpfen. Und natürlich wollen wir, dass unser Modell von Demokratie und auf Ausgleich bedachtem Sozialstaat, von Freiheit und Wohlstand größtmögliche Verbreitung in der Welt findet. Aber wir müssen auch klar sehen: In einer Welt, in der sich Kulturen wie China auf vieltausendjährige Traditionen berufen, sind unsere Vorstellungen eben nicht konkurrenzfrei. Der Wettbewerb der Systeme ist im Zuge der Globalisierung erst relevant geworden. Das ist kein Grund für uns, unsere Überzeugungen infrage zu stellen oder unsere Werte aufzugeben, ganz im Gegenteil.
Man muss nicht bis nach China schauen: Die Kluft zwischen Moral und Realismus tut sich ja schon im Umgang mit den USA auf.
Die deutsch-amerikanische Freundschaft steht nicht infrage. Gerade meine Generation weiß, dass wir Demokratie und Wohlstand ohne die Unterstützung der USA nicht erlangt hätten. So ernst der NSA-Konflikt ist: Er darf ein über Jahrzehnte gewachsenes Verhältnis der Freundschaft und der Partnerschaft nicht zerstören. Aber selbstverständlich brauchen wir mit Washington ein ernsthaftes Gespräch darüber, wie die Balance von Freiheit und Sicherheit mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Bürgerrechten neu justiert werden kann. Wir werden dabei am Ende möglicherweise nicht übereinstimmen. Aber ich bin überzeugt, wir werden näher beieinander sein, als es gegenwärtig den Eindruck macht.
Wenn Ihr Handy abgehört wird, gehört das dann schon zum normalen Leben?
Natürlich berührt mich das. Es geht ja nicht nur um ein Kanzlertelefon – ob nun das von Gerhard Schröder oder von Angela Merkel. Wenn wir uns in regelmäßigen Abständen der Freundschaft und Partnerschaft versichern, dann sollte so etwas ausgeschlossen sein.
Bis zum Fall der Mauer war Deutschland nicht wirklich ein außenpolitischer Akteur. Dann kamen Kosovo, Afghanistan, Irak, Libyen. Wie teilen Sie einer zögerlichen Öffentlichkeit mit, dass wir uns nicht immer zurückhalten können?
In den langen Jahren der Blockkonfrontation haben wir an der riskantesten Bruchstelle der Weltpolitik gelebt, waren aber durch Bündnisse beschützt. Wir mussten nicht wirklich eigene Risiken eingehen, auch wenn deutsche Außenpolitik immer Chancen für Annäherung über den Eisernen Vorhang hinweg genutzt hat. Nach 1989 musste das wiedervereinigte Deutschland erwachsen werden. Dieser Reifeprozess dauert bis heute an. Ich habe nicht vergessen, wie schwierig für uns alle die Entscheidungen über eine militärische Beteiligung an den Balkankriegen waren. Unser Nein zum Irak-Krieg blieb in Erinnerung, das Ja zu Afghanistan wurde dagegen verdrängt. Aber beides gehört zusammen.
Die USA sind ökonomisch, militärisch und nun moralisch in die Defensive geraten. Zwingt das Deutschland in die Pflicht?
Sicher haben die opferreichen Einsätze der Amerikaner der letzten Jahre zu einer politischen, finanziellen und auch psychischen Ermüdung geführt. Auch in den USA wird zunehmend bezweifelt, dass das Land im Zentrum einer unipolaren Welt steht, so wie das noch in den Bush-Jahren klang. Wir müssen übrigens deshalb auch hoffen, dass die amerikanische Initiative im Nahen Osten Erfolg hat. Scheiterte sie, würde das Amerikas Zurückhaltung in der Region eher weiter befördern. Das wäre keine gute Nachricht, auch nicht für uns.
Gibt es in Deutschland nicht einen ähnlichen Reflex wie in den USA? Die Menschen kapitulieren vor den Problemen.
Ich kann ein Gefühl von Überforderung gut nachvollziehen. Eine beliebige Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen mit außenpolitischen Themen reicht aus, um in eine Mischung aus Empörung und Verzweiflung zu verfallen. Wir sind von den Opfern, von Flucht und Vertreibung emotional berührt. Wir erwarten sofort Abhilfe, Gerechtigkeit und eine sofortige Reaktion der Politik. Es ist das moderne Dilemma der Außenpolitik, dass sie dem medial diktierten Rhythmus nicht folgen kann. Zur Entschärfung des Iran-Konflikts wurde zehn Jahre lang verhandelt. Und Politik muss erklären, warum. Sie muss sagen, wenn wir trotz öffentlicher Empörung und Erwartung nicht helfen können. Auch diese Selbstaufklärung gehört zu erwachsener Außenpolitik.
Dann müssten Sie auch erklären, warum man Assad als Verhandlungspartner ausschließt und gleichzeitig in der Schweiz mit seinen Emissären redet.
Außenpolitik kann und muss mit Widersprüchen leben. Der Umgang mit der Assad-Frage ist so ein Widerspruch. Einerseits bleibt das Ziel eine Übergangsregierung ohne Assad. Auf der anderen Seite müssen wir mit seinen Leuten reden, um für die Menschen in Homs und anderswo humanitäre Erleichterungen zu erreichen. Es geht um viel: Wenn uns nicht eine Beruhigung der Situation gelingt, dann könnte jegliche staatliche Ordnung von Syrien über den Irak bis zum Libanon erodieren. Drei zerfallende Staaten und eine endlose Folge von ethnischen und religiösen Bürgerkriegen wären eine Katastrophe, deren Auswirkungen sich nicht auf den Mittleren und Nahen Osten beschränken würden.
Es geht also um Differenzierung und Vermittelbarkeit. Werden Sie zum außenpolitischen Wanderprediger?
Die Kanzel ist nicht mein Arbeitsplatz. Aber ja: Wir müssen auch in der Außenpolitik unsere Arbeit sehr viel stärker erklären und uns nicht auf ein Selbstgespräch unter Diplomaten beschränken. Das gehört übrigens zu einem Projekt der Selbstüberprüfung, das ich gerade im Auswärtigen Amt angestoßen habe. Sind wir noch auf dem neuesten Stand – so wie wir denken und arbeiten? Sollten wir uns stärker fokussieren? Das Auswärtige Amt soll einen kritischen Blick auf sich selbst und seine Arbeit werfen. Dazu gehört der Dialog mit der Wissenschaft, aber auch mit der interessierten Öffentlichkeit über soziale Medien und öffentliche Veranstaltungen. Andere Außenministerien, etwa Norwegen, sind da weiter als wir. Ich glaube, darin steckt eine Chance; Außenpolitik zu zeigen, jenseits von Gipfel- und Katastrophenbildern.
Interview: Stefan Braun und Stefan Kornelius. Übernahme mit freundlicher Genehmigung der Süddeutschen Zeitung.