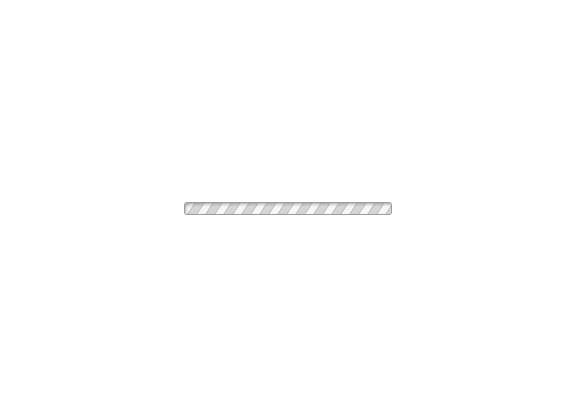Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Staatsminister Erler bei der 3. Konferenz deutscher Beschäftigter in internationalen Organisationen und europäischen Institutionen am 9. Oktober 2008
- es gilt das gesprochene Wort -
Sehr geehrte Frau Wagener,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst einmal möchte ich Sie herzlich begrüßen zu dieser 3. Konferenz der deutschen Beschäftigten in internationalen Organisationen und europäischen Institutionen. Ich freue mich, dass ich hier einen Aufschlag für Ihr Programm machen kann, und möchte gleich zu Anfang einen herzlichen Gruß und auch einen herzlichen Dank von Außenminister Frank-Walter Steinmeier ausrichten.
Wir alle hier in diesem Amt wissen, welche wichtige Rolle Sie spielen, auch was das Bild Deutschlands im Ausland angeht. In der Art und Weise, wie Sie in Ihrer Arbeit wahrgenommen werden, wird auch das Bild von Deutschland, das Prestige von Deutschland geprägt. Und umgekehrt sind Sie gewissermaßen für die Unterstützung bei Ihren Aufgaben auch ein wenig abhängig vom Prestige Deutschlands im Ausland. Das hat mich geleitet bei der Frage, worüber ich denn jetzt eigentlich sprechen soll. Im Programm steht: „Rede zur deutschen Außenpolitik“. Das ist in der Tat, mit Theodor Fontane gesagt, ein weites Feld. Das Gute daran ist, dass man sich da nun etwas aussuchen kann. Das Schlechte ist, dass man nicht so genau weiß, was Sie denn interessieren könnte. Ich habe mich für ein konkretes Thema entschieden in der – hoffentlich richtigen – Annahme, dass es für Sie von Interesse sein könnte. Ich möchte etwas über politische Prinzipien und reale Zwänge am Beispiel der deutschen Afghanistan-Politik sagen. Das ist, wie Sie sicher wissen, ein sehr aktuelles Thema, das wir im Augenblick im Deutschen Bundestag, aber auch hier in diesem Haus zu beraten haben, weil wir vor wichtigen Entscheidungen stehen. Mein Beitrag gliedert sich in drei kurze Abschnitte und soll Anregung für eine Diskussion mit Ihnen sein.
Ich möchte zunächst etwas in Erinnerung bringen zur Entstehung und zum Hintergrund des deutschen Engagements in Afghanistan. Ich will dann etwas über die politische Konzeption sagen, die hinter unserem Einsatz dort steht. Am Ende, und das finde ich persönlich eigentlich den interessantesten Teil, möchte ich versuchen, über das Spannungsverhältnis von politischen Prinzipien und dem, was dann davon in der Realität umgesetzt werden kann, zu sprechen.
Zunächst zur Entstehung und zum Hintergrund des gesamten Afghanistan-Themas: Eindeutiger Ausgangspunkt sind - und das wird manchmal vergessen - der 11. September 2001, die Anschläge des terroristischen Netzwerkes von Bin Laden auf Washington und auf New York und die sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Am 11. September fanden die Anschläge statt. Am 12. September tagte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und traf eine Entscheidung, die eine Fernwirkung bis heute hat: Er hat nämlich diese anonymen terroristischen Anschläge mit einem Angriffskrieg gleichgesetzt. Mit dieser Resolution hat er gleichzeitig eine Legitimation für eine Reaktion wie auf einen Angriffskrieg gegeben. In der Konsequenz hat die NATO am 4. Oktober 2001 zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall zur Unterstützung der Vereinigten Staaten erklärt. In derselben Konsequenz hat der für die Vereinigten Staaten wichtige Verbündete Deutschland damals unter Bundeskanzler Gerhard Schröder die uneingeschränkte Solidarität mit dem unter Schock stehenden Partner erklärt. Daraus folgte, dass man das Recht hatte, die Angreifer zu stellen, zu bestrafen, und dass man natürlich das Recht hatte, auch bis hin zum Einsatz von militärischen Mitteln, eine Wiederholung eines solchen völkerrechtswidrigen Angriffs zu verhindern. Das hat sich, nachdem man festgestellt hatte, wo diese Angriffe vorbereitet und geleitet wurden, politisch in einem Ultimatum an die Regierung in Afghanistan ausgedrückt, weil eben dort ganz offensichtlich - und auch durch Bekenntniserklärungen bestätigt - der Ausgangspunkt für die Terroranschläge war. Das Ultimatum richtete sich an die damalige afghanische Regierung der Taliban, die aufgefordert wurde, Bin Laden auszuliefern und die Ausbildungs- und Logistikzentren der Al Kaida in Afghanistan zu schließen. Eine interessante Feststellung in diesem Zusammenhang: Hätten die Taliban dieses getan, was Sie leider nicht getan haben, hätte es keine Begründung für einen Afghanistan-Krieg gegeben und er hätte in der Realität nicht stattgefunden. Dann wäre diese Herrschaft wahrscheinlich weitergegangen. In welche Richtung sie sich entwickelt hätte, kann niemand sagen.
Die Rolle Deutschlands war tatsächlich, entlang von schon vorher in der deutschen Politik entwickelten Prinzipien, zurückhaltend, was das militärische Engagement angeht. Diese Haltung beruht auf der Basis einer generellen Skepsis gegenüber militärischen Interventionen, die wir auch aus der Erfahrung der Balkan-Kriege mitgenommen hatten. Unser Fokus, unsere Prioritätensetzung liegt auf dem Versuch, eine politische Lösung zu finden. Das hat Ausdruck gefunden in dem, was wir dann Petersberg-Prozess genannt haben. Ich besinne mich noch an die erste Konferenz im Dezember 2001 auf dem Petersberg, wo versucht wurde, nach dem Loya Jirga – Prinzip Vertreter der afghanischen Gesellschaft an einen runden Tisch zu setzen, um einen Neuanfang politischer Art zu versuchen. Später setzte sich diese grundsätzliche Schwerpunktsetzung auf die Absicherung des politischen Prozesses in unserer Beteiligung an der ISAF-Mission fort. Dabei hat sich sehr schnell herausgestellt, auf welche Dimension man sich da eingelassen hatte. Es wurde der Begriff „nation building“ geprägt, ein Novum in der modernen Politik; „nation building“ deswegen, weil man festgestellt hatte, in welcher Weise dieses Land durch einen Bürgerkrieg seit 1979 physisch, materiell, aber auch mental zerstört war. Es wurde klar, dass es dort darum ging, neu anzufangen mit politischen Institutionen, mit einer politischen Kultur, mit Gesetzgebung, Justizwesen, mit Fragen der Infrastruktur, der Erwerbsmöglichkeiten der Bevölkerung bis hin zu Grenzkontrollen und vielen anderen Fragen. Diese Aufgabe musste bewältigt werden unter der wachsenden Erfahrung, dass man zwar zunächst einmal mit der amerikanischen militärischen Macht die Taliban von der Macht verdrängt hatte, dass diese aber nicht definitiv militärisch besiegt waren, sondern in Fortsetzung des Bürgerkriegs mit Unterstützung auch von bestimmten War Lords ihre eigenen Interessen vertreten haben und mit teilweise kriminellen Aktivitäten eine ständige Bedrohung für die langsam im Aufbau befindliche neue Regierung und neue Struktur in Afghanistan darstellen. Der Bürgerkrieg ist also weitergegangen.
Und dabei ist etwas passiert, was typisch ist: Es hat eine Definition einer ergänzenden Legitimation für das militärische Vorgehen gegeben, auch in der Entwicklung eines Feindbildes. Dieses hat auf die gesellschaftlichen Vorstellungen der Taliban abgezielt. Es richtete sich gegen vieles, von dem man dann erst erfuhr, nämlich in welcher Weise dort etwa mit Frauenrechten umgegangen worden war, wie das Schulwesen organisiert war. So entstand als Folge dieser zusätzlichen Legitimationsversuche der Eindruck - und das war und ist bis heute eine gefährliche Entwicklung - dass es nicht nur darum geht, eine Wiederholung des 11. September zu verhindern, sondern auch eine westliche Vorstellung von Gesellschaft in Afghanistan zu etablieren. Das ist deswegen gefährlich, weil es eine lange Tradition in Afghanistan gibt, die die Bevölkerung dagegen besonders empfindlich gemacht hat. Erstens einmal sind westliche Prinzipien eher unbekannt, etwa Demokratie oder eine starke Zentralregierung, es gibt eine lange eigene Geschichte der Kolonisierung und daraus erwachsend eine sehr starke Tendenz, sich gegen jede Form von Fremdherrschaft aufzulehnen. Und gerade unsere gesellschaftlichen Ansprüche der Gestaltung dieses „nation building“ haben es möglich gemacht, dass die Taliban mit dem Argument der Auflehnung gegen Fremdherrschaft neuen Zulauf bekommen haben. Soviel zur Entstehungsgeschichte.
Und jetzt ein paar Worte zur Konzeption des deutschen Einsatzes. Auch hier ist es eindeutig, dass unsere Haltung prinzipien- und erfahrungsgeleitet war, und zwar von einem deutschen Politikverständnis, wie es sich Anfang dieses Jahrtausends herausgebildet hatte, mit z. B. dieser großen Skepsis, dass man mit militärischen Mitteln politische Vorstellungen durchsetzen kann, mit der Zurückhaltung, was militärische Intervention angeht, und mit dem Versuch auch, klare politische Ziele als Hintergrund für ein solches eigenes Engagement zu definieren. Letztlich bedeutet dies, dass in der deutschen Politik die Forderung stark ausgeprägt ist, es müsse immer um Hilfe zur Selbsthilfe gehen. Das heißt, eigentliches Ziel des Einsatzes ist, die inzwischen etablierte Regierung in Afghanistan auf der Basis einer neuen Verfassung, auf der Basis von parlamentarischen Wahlen, auf der Basis von Präsidentschaftswahlen zu befähigen, sich selbst zu verteidigen. Und konsequent heißt das, dass man im Sinne auch einer Reform des Sicherheitssektors hilft, entsprechende Kräfte, entsprechende Sicherheitskräfte, sowohl was eine Armee als auch was eine Polizei angeht, zu formieren.
Das ist auch der Hintergrund der aktuellen Diskussion über eine Aufstockung der Obergrenze der zu entsendenden bewaffneten Kräfte von 3.500 auf 4.500, über die der Bundestag in der nächsten Woche zu entscheiden hat. Anlass ist die Feststellung, dass noch nicht genügend für die Ausbildung der ANA, der Afghanischen Nationalarmee, getan worden ist, dass dies schneller gehen muss. Es gibt bislang erst 60.000 Kräfte maximal, die tatsächlich einsatzfähig sind. Das Ziel bis 2010 sind 122.000 Kräfte.
Und Deutschland hat sich auch wieder vor dem Hintergrund dieser Prioritätensetzung darüber hinausgehend für den Aufbau einer Polizei engagiert. Denn für die Wahrnehmung einer der obersten Aufgaben einer jeden Regierung, nämlich des Schutzes der eigenen Bevölkerung, ist Polizei unter Umständen noch wichtiger als Militär. Darauf haben wir uns von Anfang an konzentriert, und zwar mit dem Aufbau einer Polizeiakademie in Kabul und heute mit dem deutlich höchsten Anteil an den internationalen Bemühungen, eine afghanische Polizei aufzubauen. Und es war eine deutsche Initiative, innerhalb der inzwischen laufenden EU-Mission zum Aufbau der afghanischen Polizei den größten Anteil zu geben und eben die Zahl der Ausbilder noch einmal zu verdoppeln. Ihre Zahl soll jetzt auf 400 ansteigen. Dazu kommen noch erhebliche bilaterale Anstrengungen der Bundesregierung. Das ist also die eine Konsequenz aus dem Grundprinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Die zweite ist, dass wir versucht haben, in der Region, in der wir eine besondere Verantwortung in Afghanistan tragen, - das ist die Region des Nördlichen Kommandos, des North Command -, ein eigenes Modell einer Wechselbeziehung von zivilem Aufbau und militärischem Schutz zu kreieren. Dem liegt das Motto zugrunde, dass ziviler Ausbau ohne einen Sicherheitsrahmen nicht möglich ist, dass es auch gar nicht verantwortbar ist, zivile Aufbaukräfte zu entsenden, wenn es nicht ein Minimum an Schutzfunktion gibt. Bei diesem Prinzip hat das Militärische eine dienende Rolle. Das Wichtigste aus der deutschen Sicht ist sichtbarer Fortschritt, ein sichtbarer Aufbau, also eine positive Entwicklung, die von der Bevölkerung wahrgenommen werden kann. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass nur dann die Trennlinie funktioniert zwischen den Aufständischen und der Mehrheit der Bevölkerung. Diese Grundüberzeugung wird in einem signifikanten Aufwuchs der Mittel über die letzten Jahre sichtbar, die wir für den zivilen Aufbau zur Verfügung stellen. Insgesamt wendet die Bundesrepublik für die Jahre 2002 bis 2010 über 1,1 Milliarden Euro für diesen zivilen Aufbau auf. Im Augenblick liegen wir in diesem Jahr bei einer Rekordhöhe von 170 Mio. Euro, davon 140 Mio. Euro aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes und 30 Mio. Euro aus dem Stabilitätspakt für Afghanistan aus dem BMZ-Haushalt.
Als dritten entscheidenden Punkt unseres Konzepts zu Afghanistan sehen wir die Bedeutung der Akzeptanz der afghanischen Regierung bei ihrer eigenen Bevölkerung. Es ist außerordentlich wichtig, dass die in den letzten Jahren dort entstandene Regierung , und natürlich das ganze politische System, als positiv wahrgenommen werden. Das ist aber im Augenblick überhaupt nicht der Fall. Von „good governance“ in Afghanistan kann man derzeit nicht sprechen. Die Bevölkerung ist eher konfrontiert mit Korruption, mit Nepotismus und mit einer allgemeinen Unfähigkeit, die Menschen zu schützen, eine effektive Verwaltung und eine funktionierende Justiz etc. zu organisieren. Die Fortschritte sind immer noch schleppend. Das bedeutet natürlich, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit der Regierung Karsai auseinandersetzen müssen. Denn es ist nicht nur die Frage, ob es schön ist, eine gute Regierung zu haben, sondern es ist eindeutig eine Sicherheitsfrage. Wenn es keine Akzeptanz der Entwicklung bei der Bevölkerung gibt, dann ist es letztlich nicht möglich, hier den Einsatz der internationalen Gemeinschaft zu einem Erfolg zu führen. In dem Zusammenhang entstehen interessante und schwierige Einzelfragen, z. B. die Frage der Drogenbekämpfung. Das ist ein Sicherheitsproblem, weil wir wissen, dass aus dem Drogenanbau unter der Kontrolle der Taliban eben genau die Mittel erwirtschaftet werden, mit denen die illegalen Milizen finanziert werden. Es handelt sich also nicht in erster Linie um eine Frage von Moral oder von gesellschaftlicher Sicherheit für die Gesellschaften, in die diese Opiumproduktion gelangt, sondern es ist ein herausragendes Sicherheitsproblem vor Ort . Es stellt sich die Frage, wer für dieses Problem verantwortlich ist. Bisher gab es einen breiten Konsens, dass die Verantwortung natürlich bei der gewählten afghanischen Regierung liegt. Aber weil die Fortschritte auf dem Gebiet bei weitem nicht ausreichen, haben wir jetzt aktuell u.a. eine Diskussion in der NATO, ob nicht doch eine wachsende Zuständigkeit auch von ISAF und der internationalen Missionen vor Ort notwendig ist. Dies ist auch deswegen ein ganz schwieriges Thema, weil derartige Aktivitäten durch Kräfte von außen im Grunde genommen wieder auf eine Einmischung in die eigentlichen Aufgaben einer Regierung hinauslaufen und als eine Intervention von außen wahrgenommen werden, die dem Stolz der Afghanen und ihrer Ablehnung solch fremder Einmischungen nur das Wort redet.
Um den Gedanken abzuschließen: Aus dieser Konzeption leitet sich auch folgerichtig unsere Vorstellung von einer möglichen Beendigung der Mission ab. Man könnte sie „exit by ownership“ nennen. „Exit“ ist also nur möglich, wenn tatsächlich so viel Eigenverantwortlichkeit und Fähigkeiten ausgebildet ist, dass die afghanische Regierung, diese Gesellschaft, sich inzwischen selbst gegen die Aufständischen verteidigen kann. Deswegen sehen wir mit großer Skepsis, und hier spreche ich für das Auswärtige Amt, wenn jetzt eine solche Ausstiegs-Diskussion in der Öffentlichkeit stattfindet, einschließlich der Wortmeldungen von Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, die verlangen, dass irgendein Datum für die Beendigung des Einsatzes in Afghanistan genannt wird. Das macht keinen Sinn. Es kann nur eine sachlich definierte Festlegung von dessen Ende geben.
Das bringt mich jetzt zum letzten Abschnitt, in dem ich einen Blick auf die Spannungsverhältnisse werfe zwischen einerseits den für unsere Außenpolitik anerkannten und konsentierten Prinzipien und andererseits den realen Zwängen und realen Entwicklungen, wie wir sie in Afghanistan vorfinden . Ich will mich auf drei Punkte beschränken, obgleich es eine Reihe weiterer interessanter Aspekte gäbe. Da ist zunächst die Frage der Einordnung des globalen Netzwerkterrorismus. Ich hatte schon die Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 12. September 2001 erwähnt. Auf die Frage, ob die damalige Einordnung der terroristischen Anschläge richtig war, sind die Vereinten Nationen nie zurückgekommen. Auf jeden Fall war sie aber der Ausgangspunkt für eine siebenjährige Praxis der Vereinigten Staaten während der zwei Amtszeiten von George W. Bush, die man mit dem Begriff „war on terrorism“ knapp beschreiben kann. War on terrorism, das war die Antwort auf die Anschläge, und dies sogar völkerrechtlich begründet durch die Qualifizierung durch die Vereinten Nationen als Angriff. Der Gedanke hat bis weit in den innenpolitischen gesellschaftlichen Bereich die amerikanische Politik geprägt.
Ein erstes Nachdenken über die eigentliche Qualität und das Neue an dieser Herausforderung hat es zwar auch gegeben, aber eher in Europa und eher in Deutschland als in den Vereinigten Staaten. In den USA war das Ereignis so prägend und wurde als so ungeheuerlich empfunden, dass es nahelag, die terroristische Bedrohung als einen Kriegsfall aufzufassen und entsprechend zu reagieren. Aber dadurch sind auch Brüche entstanden. Das ist deutlich geworden an dem Wechsel, der in Deutschland sehr bald stattgefunden hat, nämlich von der uneingeschränkten Solidarität zu der Aufkündigung dieser Solidarität, als der amerikanische Präsident seinen „war on terrorism“ mit dem Irak-Krieg fortsetzen wollte . Da war spätestens die Auseinanderentwicklung deutlich.
Wie hat sich unsere Diskussion an diesem Wendepunkt entwickelt? Sie hat in Deutschland und in der EU eine ganz andere Richtung als in den USA genommen, nämlich in Richtung Prävention. Das heißt, getragen von der Erkenntnis, dass wir nie in der Lage sein würden, mehrere solche Interventionen auch nur von den Kapazitäten her zu leisten und ausgehend von dem, was wir aus den regionalen Konflikten, insbesondere den vier Balkankriegen, gelernt haben, mussten wir den Gedanken der Prävention auf eine neue Situation global übertragen. Daraus hatten sich zweierlei Dinge entwickelt, zum einen eine geänderte Einschätzung der Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungszusammenarbeit ist auf diese Weise plötzlich zu einer sicherheitspolitischen Strategie geworden. Und in Deutschland ist Schritt für Schritt die Bedeutung der Entwicklungspolitik gewachsen, eben weil sie nicht mehr ein Thema für Sonntagsreden war, sondern plötzlich im Zentrum von Sicherheitspolitik stand. Und am deutlichsten kann man das an der Entwicklung der EU-Sicherheitsstrategie ablesen, die am 20. Dezember 2003 verabschiedet wurde. Ihr Titel sagt bereits das Wesentliche: „Ein sicheres Europa in einer besseren Welt.“ Hier ist also der Zusammenhang hergestellt worden zwischen der Sicherheit bei uns einerseits und einer globalen Konfliktprävention andererseits, die dort durch eine bessere Weltordnung verkörpert wird. Dieser Gedanke findet sich explizit in der europäischen Sicherheitsstrategie wieder. So hat sich unsere Herangehensweise an die Situation in Afghanistan im Laufe der Zeit verändert. Problematisch ist allerdings, dass die Anwendung dieser Erkenntnisse in der Praxis erst sehr spät eingesetzt hat. Wir leiden an den Spätfolgen dieser ersten Kriegsbetrachtung bis heute.
Und deswegen haben wir auch bis heute einen Gegensatz, der sich in der unterschiedlichen Bewertung der beiden Missionen in Afghanistan ausdrückt. OEF (Operation Enduring Freedom) verkörpert gewissermaßen die Konzeption des „war on terrorism“. ISAF ist dagegen die Mission, die eher auf eine politische Lösung setzt. Und deshalb haben wir in den öffentlichen Diskussionen in Deutschland bis heute den Reflex, uns von OEF zu distanzieren und unsere Beteiligung beenden zu wollen. Sie finden eine entsprechende Haltung in dem jüngsten Vorschlag des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier, nämlich unsere Beteiligung mit der KSK bei OEF aufzukündigen. Im Gegenzug soll die andere Mission, bei der es um die Absicherung des politischen Prozesses geht, verstärkt werden. Hier gibt es also einen ganz klaren Bruch zwischen Prinzipien und Realität, der bis heute fortwirkt..
Das gilt auch für den zweiten Punkt hier, den ich nennen werde. Er betrifft die Feindbildzeichnung als zusätzliche Legitimation für einen militärischen Eingriff. Ich habe schon angedeutet, dass das Schreckensbild, das wir nach den Anschlägen vom 11. September von Al Kaida hatten, schrittweise auf ihre Schutzmacht, die Taliban, übertragen wurde mit der Konsequenz, dass es einen Exklusionsreflex gegeben hat. Das heißt, die Taliban wurden aus jeder politischen Lösung ausgegrenzt. Übrigens ist das kein Einzelfall. Wir haben parallele Entwicklungen etwa im Kosovo gehabt. Einige von Ihnen werden sich sicher noch erinnern, wie auch dort eine ergänzende Legitimation zu schaffen versucht wurde, als der Kosovo-Krieg sich länger hinzog als erwartet. Damals hat z. B. der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer Vergleiche zum Nazi-Regime gezogen und den Ausruf „Nie wieder Auschwitz“ auf Kosovo bezogen. In ähnlicher Absicht hat Rudolf Scharping, damals Verteidigungsminister, mit der Bezeichnung „Hufeisenplan“ eine Dramatisierung herbeigeführt und mit einem Ausschließungseffekt verbundene Äußerungen gemacht. Oder ich könnte auch das Beispiel Hamas anführen, ein ganz vergleichbarer Exklusionsprozess, der etwas mit Legitimation zu tun hat. In Afghanistan sah es so auf einmal so aus, als ob das Frauenbild der Taliban, die Tatsache, dass sie Mädchen nicht beschulten, womöglich die Rechtsordnung der Scharia durchsetzen wollten, die Hauptursache bei der Auseinandersetzung in Afghanistan spielten. Aber das ist eine falsche und auch gefährliche Spur, weil sie tatsächlich den Eindruck erweckt, es gehe eigentlich um den Export einer gesellschaftlichen Wunschvorstellung und nicht um ein sicherheitspolitisches Thema, nämlich Verhinderung der Wiederholung der am Anfang dieses Konflikts stehenden Anschläge.
Und ganz konkret haben wir heute eine selbstkritische Diskussion, ob es richtig war, z. B. überhaupt nicht in Erwägung zu ziehen, die Taliban in eine politische Lösung im Rahmen des Petersberg-Prozesses einzubinden. Das ist damals nicht passiert. Und weil wir in dieser Tradition den Konflikt geführt haben, gibt es jetzt eine ganz aktuelle aufgeregte Diskussion darüber, dass der afghanische Präsident Karsai offensichtlich bereit ist, mit sogenannten gemäßigten Taliban über eine mögliche Zusammenarbeit ins Gespräch zu kommen, natürlich unter Ausschluss derer, die radikal sind und die jegliche Form der Zusammenarbeit ablehnen. In Deutschland, in Europa, in Amerika hat das zu erheblicher Verunsicherung geführt. Eine Folge dieser von mir so bezeichneten Zusatzlegitimation mit Hilfe einer Feindbildübertragung auf die Taliban, die dem ursprünglichen Ausgangspunkt der Konfliktursache nicht entspricht. Diese Feindbilderweiterung wird hier zu einem Hindernis.
Zusammenfassend möchte ich noch einmal die Prinzipien der deutschen Außenpolitik festhalten: Priorität politischer Lösung, Hilfe zur Selbsthilfe, Inklusion statt Ausgrenzung und jede Vermeidung eines Werteimperialismus. Oktroy von Demokratie halten wir nicht für richtig, schon gar nicht im Afghanistan-Konflikt, weil es dort politisch darum geht, die Schreckensvorstellung von einem „clash of civilizations“, von einem Kampf der Kulturen - zweifellos eines der Ziele von Bin Laden -, nicht zu akzeptieren, sondern ihm den Dialog der Kulturen entgegenzustellen. Hier sehen Sie die Widersprüche, die sich zwischen Prinzipien und Realität im Afghanistan-Konflikt ergeben haben.
Ich komme zu meinem letzten Punkt; er bezieht sich auf regionale Kooperation. Sie stellt ein festes Prinzip der europäischen und der deutschen Politik dar, das auf den positiven Erfahrungen beruht, die die Europäische Union selbst als ein Produkt regionaler Kooperation gemacht hat. Darüber hinaus haben wir aus der Erkenntnis, dass regionale Kooperation Stabilität und Frieden fördert und deswegen per se etwas Erstrebenswertes ist, diese Konzepte exportiert und angewendet , und zwar in der eigenen Umgebung - ich nenne einmal Nordische Dimension, den Barcelona-Prozess, den Stabilitätspakt für Südosteuropa, dann auch seit 2007 die Zentralasien-Strategie. Dieser Gedanke ist lange Zeit bei allen Bemühungen, den Afghanistan-Konflikt zu lösen, vergessen worden. Die Idee der Einbindung Afghanistans in seine Umgebung ist erst sehr, sehr spät, dann übrigens nicht ganz zufällig von der deutschen Seite, entdeckt und reaktiviert worden. Das bedeutete die Erkenntnis, dass wahrscheinlich eine isolierte Beseitigung der Gefährdung der gewählten Regierung in Afghanistan überhaupt nicht möglich ist, ohne die politische Situation Pakistans einzubeziehen und auch dort aktiv zu werden. Dass ein Nachbarland wie Iran direkt involviert ist, auch durch drei Millionen illegale Flüchtlinge aus Afghanistan, mit einem Anteil von 60 % am Export der Opiumproduktion aus Afghanistan und der Folge, dass schon 3.000 Grenzschützer im Iran im Krieg gegen die Drogen-Transporteure gefallen sind, schließlich mit der Konsequenz, dass wir ein riesiges Drogenproblem im Iran selbst haben, all das hat lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt. Ebenso ist Zentralasien nicht in die Betrachtung einbezogen worden, nicht z.B. die Abhängigkeit von Wasser aus Kirgistan und Tadschikistan und von Energielieferungen aus der Region.
Erst 2007, vor einem Jahr also, hat z.B. Frank-Walter Steinmeier erfolgreich bei unserer G 8-Präsidentschaft das Thema Pakistan – Afghanistan auf die Tagesordnung gesetzt. Es ist im G 8-Rahmen weiterbehandelt worden und bleibt auch unter japanischer Präsidentschaft auf der Tagesordnung. Auch erst 2007, auch nicht zufällig in unserer EU-Präsidentschaft, wurde erfolgreich die Zentralasien-Strategie der EU verabschiedet, übrigens auf der Basis der genannten Überzeugung, dass regionale Kooperation eine herausragende Rolle bei der Prävention und Lösung politischer Konflikte spielt. Dies geschah, leider muss man sagen, spät, wenn nicht sehr spät. Wenn man bedenkt, in welchem Zustand sich Pakistan mittlerweile befindet, dann weiß man, wie schwierig es ist, jetzt überhaupt noch eine Zusammenarbeit zu organisieren.
Es gibt Beobachter, die sagen, Pakistan sei auf der Bahn hin zu einem „failing state“. Zumindest kann man feststellen, dass die zentrale Regierung gerade über die Grenzregionen, die eine wichtige Rolle für den Erfolg in Afghanistan haben, nur noch einen begrenzten Einfluss hat. Und mit Iran haben wir bekanntlich noch ganz andere Probleme. Das macht es schwierig, Iran in eine regionale Lösung miteinzubeziehen. Dies ist ein weiterer Aspekt, dessen Erörterung über das Thema weit hinausgehen würde.
Ich habe Ihnen drei Beispiele angeführt, die zeigen, dass die Orientierung an politischen Prinzipien schwierig ist, wenn man in einen internationalen Prozess eingebettet ist. Der Prozess lenkt zum Teil von der Ausrichtung auf die Prinzipien ab, teilweise macht er auch vergessen, auf jeden Fall macht er es sehr schwierig, die Prinzipien in jedem Einzelfall konsequent anzuwenden. Ich glaube aber, dass gerade das afghanische Beispiel zeigt, dass die geschilderten politischen Prinzipien der deutschen Außenpolitik richtig sind, dass sie aber aus verschiedenen Gründen nicht oder zu spät angewandt wurden. Es wird aber auch klar dass es nicht darum gehen kann, irgendeinen Strategie-Wechsel vor Ort in Details zu machen, sondern dass es eher um eine entschlossene Rückbesinnung auf wirksame, politische Prinzipien gehen muss, Prinzipien, mit denen wir an anderer Stelle positive Erfahrungen gemacht haben.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.