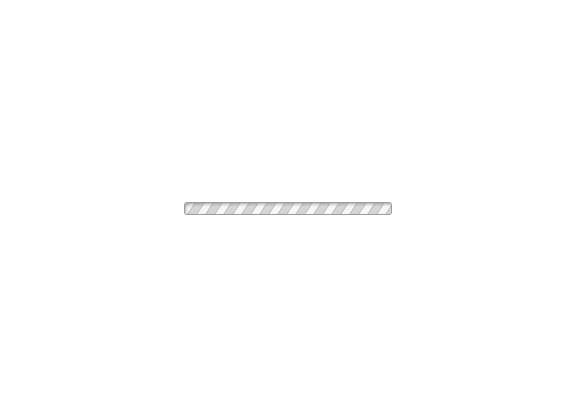Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Bundesminister Steinmeier bei der Eröffnung der Reihe „Transatlantische Gespräche“
Lieber Herr Scherer, lieber Thomas Krüger, meine Damen und Herren, vor allem, lieber Jeremy Rifkin,
wir sollten zuallererst diejenigen aufklären, die das heute Abend für eine ungewöhnliche Paarung von Reden und Rednern halten. Wir beide sind jedenfalls geübt darin! Ich erinnere mich gern an unsere gemeinsame Veranstaltung wenige Schritte von hier entfernt, 2004 im Kanzleramt.
Mitten in der Phase europäischer Stagnation hast Du uns erklärt, warum die ganze Welt den europäischen Traum träumt. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich mich diesem Traum genähert habe – ob erst die Rede und dann das Buch oder umgekehrt. Fest steht: Dieser optimistische Blick auf Europa hat mich bis in die deutsche Ratspräsidentschaft beeinflusst und meine Wahrnehmung Europas durchaus neu geprägt.
Das begonnene Gespräch setzen wir heute fort, nicht über Europa, sondern über die Aktualität deutsch-amerikanischer, europäisch-amerikanischer Beziehungen. Und einen besseren Ort für eine solche Begegnung gibt es kaum.
Die Kongresshalle ist „transatlantisches Terrain“ par excellence! 50 Jahre alt, jetzt nach einer Generalüberholung neu eröffnet und mit einem fulminanten Programm zu New York startend – steht sie für Amerikas Präsenz in dieser Stadt, das Eintreten für ihre Freiheit und den demokratischen Neubeginn in schwieriger Zeit.
Sie erinnert daran, was wir Amerika verdanken. Unser ganzes Volk, aber auch gerade diese Stadt.
John F. Kennedy’s Worte, in dieser Halle 1963 gesprochen: „Ich werde gehen, aber Amerika wird bleiben“, sind ja auf eine bemerkenswerte Weise bis heute gültig geblieben. Berlin ist eine Drehscheibe amerikanischer Institutionen, Universitäten und Denkfabriken geworden, deren Wirkungsradius weit über Berlin hinausgeht.
Wo kann man also besser über die – aus meiner Sicht notwendige – Erneuerung des transatlantischen Verhältnisses nachdenken als in dieser Stadt und in diesem Haus?
Dieses Haus, das für beides steht: ein enges transatlantisches Verhältnis und die Offenheit für die Kulturen der Welt.
Und wer wäre ein besserer Partner, um dieses Nachdenken nicht gleich wieder in die altbekannten transatlantischen Klagelieder münden zu lassen, als Jeremy Rifkin?
Der die mächtige Metapher vom „American Dream“ aufnimmt und uns Europäer daran erinnert, dass auch wir einen eigenen Traum haben – und dass viele Menschen, auch in Amerika, diesen Traum mit uns teilen wollen.
Den Traum einer solidarischen Welt, den Traum von Einigkeit in Vielfalt, den Traum einer Welt, in der Menschen arbeiten, um zu leben, und nicht leben, um zu arbeiten, den Traum von nachhaltiger Wirtschaft und der Offenheit für andere Kulturen.
Ich habe immer wieder an Deine Worte denken müssen, gerade auch im letzten halben Jahr, als es darum ging, der Europäischen Union nach einer Zeit der Verzagtheit wieder Mut und Richtung zu geben. Und ich glaube wie Du: Europa hat seine Zukunft als Partner Amerikas bei der menschlichen Gestaltung unserer Welt.
Europa braucht ein starkes, handlungsfähiges Amerika. Und Amerika braucht ein starkes, handlungsfähiges Europa. Ein Europa, das Gewicht hat in der transatlantischen Partnerschaft, aber sich nicht als Gegengewicht definieren muss.
Ein Traum? Vielleicht. Aber ohne solche Träume verlieren wir uns zu leicht in den Niederungen unserer Alltagsprobleme, in Stimmrechten und Doppelhüten und anderen diplomatischen Feinsinnigkeiten. Und viele von Ihnen wissen, was diese Formeln aus der europäischen Gremienwelt bedeuten.
Und damit sind wir auch schon mitten in der „transatlantischen Sache“.
Kaum eine internationale Beziehung ruht auf einer so soliden Basis: Die USA und die EU sind füreinander die wichtigsten Partner. Europa erinnert sich dankbar an die Rolle Amerika bei der Erneuerung der Demokratie und dem Wiederaufbau. Es gibt das Atlantische Bündnis, das intensive Netzwerk der bilateralen und EU/US Konsultationen. Die transatlantischen Handels- und Investitionsströme übertreffen alle vergleichbaren Wirtschaftsbeziehungen um Längen - nur eine Zahl zur Illustration: 1 Mrd. an Handelsvolumen wird täglich zwischen der EU und den USA erwirtschaftet.
Und dennoch ist unverkennbar, dass sich Einstellungen in unseren Gesellschaften zum jeweiligen transatlantischen Gegenüber wandeln.
Auch hier ein Beispiel: Befürworteten in den 90er Jahren noch 64% der befragten Europäer eine Führungsrolle der USA in den internationalen Beziehungen, so waren es 2007 nur noch 31%. Auch Meinungsumfragen in den USA zeigen abnehmendes Interesse an Europa. Und wer in Washingtoner Denkfabriken Karriere machen will, lernt jetzt chinesisch oder arabisch.
Man mag als tröstlich empfinden, dass die Werte, die die gegenseitige Grundsympathie messen, nicht wesentlich verschlechtert haben. Doch Freundschaft und Partnerschaft mit den USA sind mittlerweile für viele nicht mehr so ganz selbstverständlich.
Die entscheidende Frage ist: Sind wir uns – diesseits und jenseits des Atlantiks – noch wichtig genug? Oder führen unterschiedliches Gewicht und veränderte globale Interessenlagen zu einer wachsenden Distanz zwischen den transatlantischen Partnern?
Die Antwort darauf ist nicht leicht mit Ja oder Nein zu geben!
Sicher, es gibt Veränderungen! Und Politik auf beiden Seiten des Atlantiks hat die Aufgabe, dass aus Veränderung keine Entfremdung wird.
Einiges von dem transatlantischen Unbehagen hat schlichtweg damit zu tun, dass die Zeiten seit 1989 andere geworden.
Der Fall der Mauer hat die Sicherheitsfunktion der USA in und für Europa nicht nur drastisch verändert, sondern auch strategische Interessen der Vereinigten Staaten in andere Weltteile gelenkt.
Der 11.September und die starke gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus haben zwar gezeigt, wie stark trotz allem die Bande der Solidarität sind. Wir alle erinnern uns noch an die vielen Menschen, die auf den Straßen Berlins spontan ihr Mitgefühl mit den Opfern und ihren Hinterbliebenen zum Ausdruck gebracht haben. Und den Kritikern unseres Afghanistan-Engagements sage ich immer: Unsere gemeinsame Pflicht ist und bleibt es, zu verhindern, dass Afghanistan wieder zum Rückzugsraum skrupelloser Terroristen wird.
Aber wir alle leiden auch an den Wunden, die der Irak-Krieg auf beiden Seiten des Atlantik geschlagen hat.
Viele Europäer sehen in dem unilateralen Ansatz, der diesem Krieg vorausging, eine verhängnisvolle Abkehr von der traditionellen Bündnisorientierung amerikanischer Nachkriegsdiplomatie.
Viele in Europa glauben, wie das der Harvard-Professor Joe Nye umschrieben hat, dass Amerikas bleibende Attraktivität entscheidend von den smart power-Elementen abhängt. Und dass demzufolge eine zu starke Betonung militärischer Macht – Stichwort Venus und Mars – am Ende kontraproduktiv ist.
Und die Amerikaner werfen uns Blauäugigkeit und Zerstrittenheit vor.
Gerade hier in der Kongresshalle sage ich: Europa ist mit amerikanischer Gestaltungsmacht gut gefahren. Doch je weitsichtiger und multilateral eingebetteter sie war, desto besser!
Einfluss – das ist ja eine zutiefst europäische Erfahrung - ist eben nicht nur eine Frage militärischer Macht, sondern ist die Fähigkeit, die Köpfe und vor allem die Herzen der Menschen zu erreichen.
Amerika war nie nur Macht, immer auch Idee. Und es hat Europa auf den Weg der Freiheit zurückgeführt, weil es mit dieser Idee glaubwürdig war.
Bei allen kritischen Fragen, die wir aneinander haben – wir dürfen im transatlantischen Verhältnis nie vergessen, was alles auf der Haben-Seite steht.
Da ist zunächst und vor allem das Netzwerk der in ihrer Vielfältigkeit nicht mehr überschaubaren und in keiner Handelsbilanz erfassten menschlichen Verbindungen: Kontakte, Freundschaften, Affinitäten in beiden Richtungen über den Atlantik.
Allein 43 Mio. Amerikaner bekennen sich zu ihren deutschen Wurzeln - die größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Es gibt im Schnitt täglich 10 Mio. E-Mails hin und her – ein kontinuierliches deutsch-amerikanisches Gespräch Tag für Tag.
Diese menschlichen Bindungen sind so stark, dass sie auch Temperaturschwankungen verkraften. Das ist gut so! Wahrscheinlich werden die gemeinsamen Werte, von denen so oft die Rede ist, durch nichts besser belegt als diesen millionenfachen Austausch von Menschen, Ideen und Lebensphilosophien über den Atlantik hinweg.
Der Grund, warum Europäer und Amerikaner letztendlich so viel und so erstaunlich kreativ miteinander zu tun haben wollen, ist, dass wir einfach viel gemeinsam haben – trotz den Unterschieden bei den Mentalitäten. Wie heißt es so richtig bei Alexis von Tocqueville: „In Amerika habe ich mehr gesehen als Amerika“. Denn im transatlantischen Gespräch sehen wir uns selbst vielfach mit!
Auch Jeremy Rifkins Buch über den europäischen Traum ist ja so ein Spiegel, in dem Europäer und Amerikaner am Ende sehen, wie ähnlich sie einander sind.
Was bedeutet diese gemischte Bilanz für die Zukunft des transatlantischen Verhältnisses?
Lassen Sie mich darauf eine Antwort versuchen, die weniger eine Voraussage als vielmehr eine Handlungsanweisung ist: Wenn wir Entfremdung verhindern wollen, müssen wir eine neue transatlantische Agenda entwickeln!
Nur wenn die Menschen sehen, dass wir gemeinsam an Lösungen für die großen Zukunftsfragen arbeiten, gewinnen wir ihre Köpfe und Herzen wieder voll für die transatlantische Sache.
Und diese Sache ist und bleibt wichtig! Für Europa, für Amerika, und für den Rest der Welt.
Denn immer deutlicher wird, dass die zentralen Fragen der Menschheit in den nächsten 100 Jahren nur noch gemeinsam zu lösen sind: Energie, Rohstoffe, Klima, der Schutz vor Krankheiten, Armutsbekämpfung, der Kampf gegen den Terrorismus.
Niemand – selbst der Stärkste nicht – kann das allein. Niemand kann allein die Erderwärmung stoppen, Energiesicherheit herstellen, Währungskrisen vorbeugen, Proliferationsrisiken begrenzen und terroristische Gefahren abwehren.
Auch transatlantische Partnerschaft allein kann diese Probleme nicht lösen. Aber keines dieser Probleme ist leichter lösbar ohne sie!
Neue Themen rufen aber auch nach neuen Bühnen. Zu Recht bildet die NATO nach wie vor ein Herzstück gemeinsamer westlicher Sicherheit. Aber die Überzeugung wächst, dass im ersten globalen Jahrhundert viele Fragen nicht mehr in erster Linie militärisch oder in militärischen Bündnissen zu lösen sind, sondern vor allem mit zivilen Instrumenten.
Völkerrecht, technische Entwicklung, erneuerbare Energien können einen Krieg um Öl und Gas auf intelligentere Weise überflüssig machen als Soldaten und Panzer. Um solche sicherheitspolitischen Fragen sachkundig diskutieren zu können, brauchen wir neben der NATO neue Foren für das verbindliche Gespräch.
Welche Themen gehören ganz oben auf eine erneuerte transatlantische Agenda?
Lassen Sie mich drei nennen, die mir besonders am Herzen liegen.
Ein erstes Thema, wie soeben angedeutet, ist Energieversorgungssicherheit und Klimaschutz. Das ist zu einem Schicksalsthema geworden – ein Thema, das unmittelbar darüber entscheidet, ob wir in der globalen Welt weiter sicher leben können.
Welche vor kurzem noch ungeahnten Konfliktlinien sich durch den Klimawandel auftun, habe ich auf meiner Reise nach Spitzbergen vor wenigen Wochen gesehen – nicht nur am Wettlauf der Arktisanrainer um den Nordpol, bis hin zu russischen Flaggen am Meeresboden.
Der Wettlauf um Energie und Rohstoffe ist in vollem Gange – und wird sich mit wachsenden Bevölkerungen und steigendem Wohlstand dramatisch verschärfen.
Was der weltweit steigende Energie- und Rohstoffbedarf für uns alle bedeutet, kann man ermessen, wenn man nur den durchschnittlichen Energieverbrauch eines Japaners auf die 2,4 Mrd. Einwohner Chinas und Indiens hochrechnete. Würde jeder von ihnen soviel Energie verbrauchen wie ein Japaner, dann würde sich der Weltenergiebedarf auf einen Schlag verdoppeln – und das bei jetzt schon hoher Instabilität in vielen Ressourcenländern.
Hier kommen massive und neuartige Verteilungskonflikte auf uns zu - wenn wir nicht frühzeitig und gemeinsam gegensteuern: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Reduktion von CO²-Emissionen sind die Stichworte!
Deshalb ist eine kooperative Energiesicherungspolitik Kernbestandteil einer vorausschauenden Außenpolitik, wie ich sie verstehe. Europa bewegt sich jetzt in die richtige Richtung. Aber ohne die USA, den Hauptemittenten von CO²-Gasen, werden wir keinen Durchbruch erzielen können. Ohne die USA werden wir auch die wichtigen Schwellenländer nicht an Bord holen können.
Wir müssen hier aber selbstkritisch sein: Die industrialisierte Welt, besonders die USA und Europa, haben zur ökologischen Krise viel selbst beigetragen. Wachstum ist für uns in Europa wichtig, und in den Schwellenländern umso mehr. Natürlich können wir Europäer den Menschen in anderen Weltteilen nicht Wasser predigen und selbst weiter Wein trinken. Deshalb müssen wir jetzt bei der Lösung gemeinsam Führung zeigen.
Anfänge sind gemacht - beim zurückliegenden EU-USA-Gipfel in Washington und beim G8-Gipfel in Heiligendamm: mehr Energieunabhängigkeit durch Biokraftstoffe, sparsame und innovative Automobile, eine saubere Nutzung der Kohle.
Und ich bin sicher, dass das Potential der Technologiezusammenarbeit noch lange nicht ausgeschöpft ist. Die Ingenieure von Bosch, BMW und SAP in Kalifornien, mit denen ich vor kurzem gesprochen habe, hatten jedenfalls leuchtende Augen, als sie von ihren gemeinsamen Projekten mit amerikanischer Wissenschaft und Wirtschaft erzählten.
Dieser hohe Stellenwert von Klimaschutz mag noch nicht überall in den USA herrschende Meinung sein. Mit denen, die klimapolitisch am selben Strang wie wir ziehen, kann es aber eine gemeinsame „coalition of good will“ geben.
Hierüber habe ich vor drei Wochen in Kalifornien mit Gouverneur Schwarzenegger gesprochen. Auch darüber, wie wir eine Verbindung des bestehenden EU-Emissionshandelssystems mit den entstehenden Systemen in anderen Industrieländern wie z.B. USA, Kanada und Australien hinkriegen. Wir haben dazu gerade erst gemeinsam mit dem Potsdamer Institut für Klimaforschung konkrete Vorschläge entwickelt. Kalifornien und andere wichtige US-Bundesstaaten haben großes Interesse bekundet.
Lassen Sie mich ein zweites Thema erwähnen, das nicht in die Zuständigkeit des Bundesaußenministers fällt, aber unsere Beziehungen entscheidend prägt: Ich rede von den internationalen Finanzmärkten.
Wie abhängig wir voneinander sind, hat in den letzten Wochen die Kreditkrise in den USA gezeigt. Faule Hypothekenkredite in den USA sandten Schockwellen bis nach Berlin und Dresden.
Schon im Frühjahr hatte Peer Steinbrück seinen Finanzminister-Kollegen bei den G7 Vorschläge gemacht, wie die Finanzmärkte transparenter und sicherer gemacht werden können – nicht zuletzt auch im Bereich der Hedge Fonds.
Er hat dafür anfangs viel Kritik einstecken müssen. Nach den Ereignissen der letzten Wochen sind die Kritiker leiser geworden – und ist die Bereitschaft gewachsen, sich auf diesen Weg ernsthaft einzulassen – auch in den USA. Und das ist gut so!
Und lassen Sie mich ein drittes Thema erwähnen, dass für den Weltfrieden immer wichtiger wird. Ich meine das Thema Abrüstung und Proliferation.
Ich habe mich gefreut, dass nicht nur die deutsche Außenpolitik, sondern auch so erfahrene amerikanische Außenpolitiker wie Henry Kissinger, George Shultz und Sam Nunn in der letzten Zeit warnend darauf hingewiesen haben, dass Abrüstung und Non-Proliferation keine Themen von gestern sind.
Angesichts des Aufstiegs neuer Mächte sind Abrüstung und Non-Proliferation ja fast noch brisanter als im Kalten Krieg. Das Gleichgewicht des Schreckens folgte ja noch einer gewissen Rationalität. Ich bezweifle, dass das in einer Welt mit einer Vielzahl neuer Nuklearmächte ebenso gälte.
Das ist der Grund, warum wir uns trotz vieler Frustrationen und Enttäuschungen weiter geduldig und nachdrücklich um den Iran-Konflikt kümmern müssen. Warum es uns gemeinsam mit den Amerikanern, Russen und Chinesen gelingen muss, ihn von nuklearen Abenteuern abzuhalten. Nicht mit Kriegsgetrommel, sondern mit Entschiedenheit und kluger Diplomatie, Instrumente klassischer Außenpolitik, die uns auf der koreanischen Halbinsel ganz offenbar weiter gebracht haben.
Aber auch unabhängig vom iranischen Nuklearthema gehören Abrüstung und Rüstungskontrolle wieder auf die internationale Agenda.
Wir haben ein europäisches Interesse, dass unsere in Jahrzehnten entwickelte Abrüstungsarchitektur nicht rückabgewickelt wird.
Und wir arbeiten daran, dass auch die USA wieder sehen, dass das, was in Europa als Frucht der Entspannungspolitik gelungen ist – ein verlässliches System von Vertrauensbildung, Transparenz und Kontrolle – beispielgebend für andere Weltregionen sein kann.
Das - und nicht etwa gefahrenvergessene Blauäugigkeit - ist der Hintergrund für unsere Skepsis gegenüber den amerikanischen Plänen zur Durchsetzung von Missile Defense im Konflikt mit einem Teil Europas.
Und das ist auch der Grund, weshalb wir gegenüber unseren amerikanischen Partnern dafür werben, bei aller Kritik an gewissen Entwicklungen in Russland nicht zu vergessen, dass wir einander brauchen – im Nahen und Mittleren Osten, auf dem Balkan oder wo sonst Konflikte schwären.
Lassen Sie mich dazu an dieser Stelle etwas grundsätzlicher werden. Mit Sorge beobachte ich die wachsende Tendenz, auf Dinge, die uns nicht gefallen – und dazu gehört im Falle Russlands auch die Aussetzung des KSE-Vertrages mit Abschottung, mit Sanktionsdrohungen und Gesprächsabbruch zu reagieren. Ich weiß: Das sichert allemal Schlagzeilen und Öffentlichkeit. Am Ende ist es in der Regel zuviel Innenpolitik in der Außenpolitik.
Vernünftig ist das nicht! Wie viele Beispielsfälle zeigen. Auch wenn es manche langweilt: Vernünftig ist das mühselige, oft im Verborgenen stattfindende Unterfangen, verloren gegangenes Vertrauen wieder herzustellen oder neu aufzubauen. In diesem Sinne ist der politische Ansatz der Entspannungspolitik auch in einer veränderten Welt aktuell.
Und damit kommen ich zu einem letzten Punkt, der dann auch den Bogen schlägt zur heutigen Nutzung dieses Hauses: Ich meine die Aufgeschlossenheit und Sensibilität für die Kulturen dieser Welt.
Die Verstärkung unserer Kultur- und Bildungsarbeit zentrales Anliegen meiner Außenpolitik. Gerade in einer Welt mit neuen Machtzentren müssen wir darauf sehen, dass unsere eigenen Kultur verständlich und lesbar bleibt. Und wir müssen in einer solchen Welt versuchen, Gründe für Missverständnisse, Skepsis und Ablehnung tiefer zu erfassen.
Deshalb halte ich den kulturellen Austausch über den Atlantik für so wesentlich. Gerade über die großen anderen Kulturen der Welt, denen ja dieses Haus in erster Linie gewidmet ist. Also nicht als gegenseitige Selbstbespiegelung, sondern als Versuch, sich über die gemeinsamen westlichen Werte und Haltungen zu verständigen und uns anderen gegenüber verständlich zu machen.
Deshalb habe ich mich auch für eine massive Steigerung des Kulturhaushaltes im kommenden Jahr eingesetzt – und bin nach vielen Gesprächen mit Abgeordneten zuversichtlich, dass der Bundestag diesem Vorschlag folgen wird.
In diesem Sommer hat Barack Obama in der Zeitschrift „Foreign Affairs“ unter dem Titel „Renewing American Leadership“ einen außenpolitischen Grundsatzartikel publiziert. Er warnt darin vor einem Amerika, dass sich nach der traumatischen Erfahrung des Irak-Krieges nach innen wendet und den Problemen der Welt den Rücken kehrt.
Eine Sorge, die viele Republikaner teilen, wie ich aus den Gesprächen während meiner letzten USA-Aufenthalte erfahren habe.
Obama plädiert für eine Rückbesinnung auf die amerikanische Führungsrolle unter Roosevelt und Kennedy. Eine Führungsrolle, die ausgeht von der Erkenntnis, dass Sicherheit und Wohlstand jedes Amerikaners abhängt von Sicherheit und Wohlstand der gesamten übrigen Welt.
„Common security“ und „common humanity“ – das müssen die Prinzipien einer neuen transatlantischen Agenda sein. Einer Agenda, die sich dem Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Humanität stellt und es im Sinne unserer gemeinsamen Werte zu lösen versucht.
Kein Traum, würde Jeremy Rifkin sagen, sondern eine Aufgabe, die vor uns steht und der wir uns nicht entziehen dürfen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.