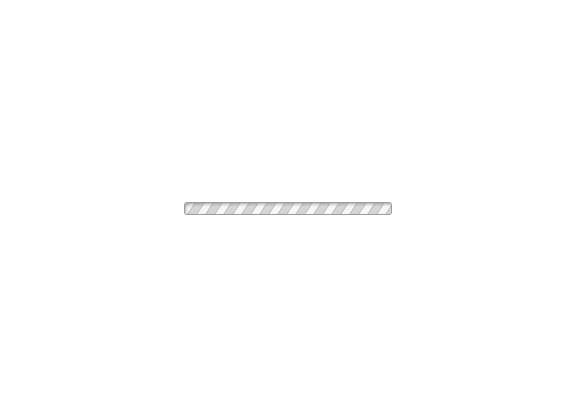Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Bundesaußenminister Steinmeier bei der Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion am 25.09.2006 in Berlin
Es gilt das gesprochene Wort!
Vor 50 Jahren waren Frankreich, die Niederlande, Italien oder Spanien für uns Deutsche unbekanntes Ausland. Der Schrecken des Zweiten Weltkriegs war in fast jeder Familie noch lebendig. Viele Innenstädte sahen aus wie Kraterlandschaften, Millionen Kinder wuchsen ohne Väter auf, unzählige Flüchtlinge bauten sich eine neue Existenz aus dem Nichts. Ganze Völker in Europa belauerten sich mit Misstrauen und unterdrückten nur mühsam ihre Rachegelüste.
Das war die Situation in den 50er Jahren, als weitsichtige Politiker nach zaghaften Anfängen die Römischen Verträge unterzeichneten. Was sich seither verändert hat, muss ich hier im Saal niemandem erläutern. Ich will nur sagen: Welche Leistung wir Europäer alle miteinander in den vergangenen 50 Jahren vollbracht haben – aber auch wie viel historisches Glück wir dabei hatten – haben wir vergessen.
Die Einigung Europas hat uns Frieden und Wohlstand beschert, freie Grenzen und 19-Euro-Urlaubsflüge nach Mallorca, Krakau oder Dublin. In Ländern, die wir früher nur aus dem Schulatlas kannten, zahlen wir heute in derselben Währung wie zu Hause. Und wer in Europa ein neues Produkt erfindet, der kann es ohne Zoll und Handelsschranken an 450 Millionen Menschen verkaufen – im größten Binnenmarkt der Welt.
Alle Länder in der Europäischen Union haben davon profitiert, dass sie nationale Rechte und Kompetenzen freiwillig abgegeben haben und wesentliche Dinge gemeinsam regeln. Wir Deutsche sind nicht nur Nettozahler, sondern auch Exportweltmeister. Und zwei Drittel unserer Waren und Dienstleistungen gehen nicht in die USA, nicht nach Japan, Indien oder China, sondern in unsere Partnerländer in der EU. Spanien hat seit dem Beitritt zur EU die Arbeitslosigkeit von 22 auf 8 Prozent gesenkt. Irland, über Jahrhunderte ein Land von Auswanderern, beschäftigt inzwischen Zehntausende von Arbeitnehmern aus Osteuropa – und sogar einige aus Deutschland.
Das Problem an diesen Erfolgszahlen ist: Die Menschen, für die wir Politik machen, beeindruckt das wenig. Ich meine das nicht als Vorwurf, sondern als Feststellung, wenn ich sage: Viele Menschen empfinden den Frieden und Wohlstand, den wir genießen, als selbstverständlich gewordene Normalität. Sie treibt längst etwas ganz anderes um: Sie fürchten, dass sie ihren Lebensstandard in den kommenden Jahren und Jahrzehnten schleichend einbüßen könnten – oder ganz verlieren.
Die Furcht, bei der Globalisierung als Verlierer dazustehen, hat auch die Glaubwürdigkeit der europäischen Idee beschädigt. Das Kernversprechen der europäischen Einigung lautete, dass sie jedem auch ganz persönliche Vorteile bringt. Und genau daran glauben viele Menschen – auch viele Anhänger und Wähler der Sozialdemokraten – nicht mehr.
Ich kann diese Skepsis in gewissem Maße nachvollziehen. Wir alle wissen, wie groß der Einfluss der EU auf die Politik in Deutschland und den anderen Nationalstaaten inzwischen ist. Entscheidungen, die in Brüssel fallen, greifen immer häufiger in das ganz konkrete Alltagsleben der Menschen ein. Die Bürgerinnen und Bürger verlangen mehr Lebensnähe von diesen Entscheidungen in Brüssel – siehe die EU-Dienstleistungsrichtlinie. Und überall in Europa fordern die Menschen mehr Respekt vor ihren nationalen Identitäten.
Ich will hier nicht alle Facetten und Gründe der Euroskepsis ausleuchten. Aber ich möchte betonen: Wir müssen die Bedenken, die viele Menschen zum Thema Europa äußern, ernst nehmen und dürfen sie nicht beiseite wischen. Wir, die wir Verantwortung tragen in der Politik, müssen den Menschen mehr zuhören, den Dialog suchen und europäische Politik viel genauer erklären. Vor allem müssen wir aufhören, Europa schlecht zu reden; aufhören, für jede nationale Fehlentwicklung die europäische Ursache zu suchen.
Nur wenn die Menschen wieder spüren, dass sich das gemeinsame Handeln Europas für sie auszahlt, kann die europäische Idee neue Popularität gewinnen. Dafür müssen wir mehr bieten als Luftballons und Faltblätter an den EU-Festtagen. Ich bin sicher: Als reines Elitenprojekt hat Europa keine Zukunft.
Ich spreche mich deshalb für wir einen Perspektivwechsel in der Europapolitik aus. Wir müssen Europa „neu denken“. Wenn der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker sagt: „Wer heute nach den Gründen für Europa fragt, der sollte über einen Soldatenfriedhof gehen“ – dann sage ich: Jean-Claude, du hast Recht! Aber das reicht nicht – und er sieht es natürlich nicht anders! Wir können Europa in der Hauptsache heute nicht mehr aus dem Blickwinkel der Nachkriegszeit betrachten, und auch nicht aus der Sicht von vor dem Fall der Mauer. Wir müssen das Projekt Europa vielmehr von den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts her neu durchdenken und begründen.
Die vergangenen 50 Jahre standen im Zeichen einer stetigen Annäherung und Verflechtung heterogener Nationalstaaten. Jetzt müssen wir klären, welche Positionen Europa gemeinsam in einer Welt vertritt, die eng zusammengewachsen ist und sich weiter rasant verändert – und welche nicht.
In vielen zentralen Bereichen gibt es kein besseres Argument für ein einiges Europa als die Auswirkungen der Globalisierung. Die Kraftverhältnisse in der Welt verschieben sich. Wir erleben den Aufstieg Chinas, Indiens und weiterer Schwellenländer; Russland findet zu neuer Stärke. Damit die USA und Asien nicht allein die Weichen für die Zukunft stellen, muss Europa seine Stärken bündeln. Nur gemeinsam können wir Europäer unsere Wertvorstellungen behaupten und verbreiten, unseren Wohlstand sichern und ausbauen. Wir brauchen dazu mehr als nur ein „Europa der Projekte“, wie viele es jetzt als Lückenbüßer im Munde führen, bis die aktuelle Krise sich hoffentlich aufgelöst hat. Was die Menschen sich dagegen zu Recht erhoffen, sind konkrete Perspektiven und Resultate für eine sichere Zukunft in, mit und durch Europa.
Felder für gemeinsames Handeln sind zum Beispiel die wirtschaftliche Modernisierung, die Sicherung der Energieversorgung, die Bekämpfung von Terrorismus und internationaler organisierter Kriminalität, die langfristige Stabilisierung der europäischen Nachbarregionen und der Kampf für eine lebenswerte Umwelt.
Aber mit dem Hinweis auf die Globalisierung können wir nicht einfach beliebig weiter Zuständigkeiten nach Brüssel verlagern. Die Verflechtung auf EU-Ebene hat nach 50 Jahren eine hohe Dichte erreicht. Deshalb erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir den konkreten Mehrwert europäischer Politik in jedem Einzelfall erklären und glaubhaft machen können.
Dies muss der Maßstab unserer Europapolitik sein. In vielen Bereichen können wir den europäischen Mehrwert auch gut erklären – ich habe gerade Beispiele genannt.
Aber es gibt es auch Bereiche, aus denen Brüssel sich heraushalten sollte, weil sie besser in den Mitgliedstaaten beantwortet werden können. Dazu gehört zum Beispiel die Struktur unserer sozialen Sicherungssysteme. Die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften waren immer der Auffassung, dass Europa nicht „sozialer“ wird, wenn wir die Gestaltung dieser Systeme Brüssel überlassen. Wir alle kämpfen für ein soziales Europa. Aber es gibt kein einheitliches europäisches Sozialmodell, sondern viele ganz unterschiedliche Modelle, in denen sich lange nationale Traditionslinien widerspiegeln. Die sollten wir respektieren, und wir sollten das den Menschen klar sagen.
Denn diese klaren Aussagen würden manche irrationale Angst beseitigen - und manche irrationale Debatte über die Erweiterung der EU nicht entstehen lassen. Viele Menschen befürchten doch im Kern, dass Brüssel irgendwann auch die Renten- und Gesundheitssysteme auf der Mitte zwischen deutschen und rumänischen Standards angleicht. Darum darf es niemals gehen.
Das ist die Kulisse, vor der wir Deutsche am 1. Januar für sechs Monate die Präsidentschaft in der EU übernehmen. Ich möchte Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aufgaben in dieser Zeit präsentieren. Was sind die zentralen Bereiche, in denen wir während dieser Zeit Ergebnisse erzielen müssen?
Am 8. und 9. März 2007 findet in Brüssel der Europäische Frühjahrsgipfel statt. Dort stehen die EU-Strategie für Wachstum und Beschäftigung sowie das Thema Energie im Mittelpunkt.
Die Strategie für Wachstum und Beschäftigung braucht neue Impulse. Beim Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft liegt die EU hinter den selbst gesteckten Zielen zurück. Europa muss zu einem globalen Zentrum für Forschung, Bildung und Innovation werden. Nur dann können wir unser europäisches Gesellschaftsmodell und unsere sozialen Standards verteidigen.
Wir Sozialdemokraten haben dieses Modell entscheidend mitgeprägt, und deshalb ist es unsere Aufgabe, mit aller Kraft für dieses Ziel zu arbeiten. Wir setzen uns dafür ein, dass auch in Zukunft jeder Einzelne sein Leben in die Hand nehmen und durch Leistung vorankommen kann. Wir stehen für ein tolerantes Zusammenleben mit Anderen, für die solidarische Absicherung vor Notfällen und für eine kinder- und familienfreundliche Arbeits- und Lebenswelt. Erfolgreiche Wirtschaftspolitik ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um dieses Gesellschaftsmodell zu bewahren und weiter zu entwickeln.
Darum brauchen wir eine erhebliche Steigerung der Investitionen in Forschung, Bildung und Ausbildung. Im globalen Wettbewerb ist Wissen ein strategischer Rohstoff. Und wir brauchen eine enge Verzahnung von Ausbildung, produktnaher Forschung und innovativer Technologie. Während unserer Präsidentschaft wollen wir mit zahlreichen Einzelmaßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken und Bürokratie abbauen. Das reicht von der Marktliberalisierung für Postdienstleistungen über Maßnahmen für preisgünstigeres Mobiltelefonieren und Kostensenkungen bei Geldüberweisungen bis zu Vereinfachungen beim Zoll und beim Patentrecht.
Eine sichere Zukunft gibt es außerdem nur mit einer gesicherten Energieversorgung. Der globale Wettlauf um die Energiereserven hat begonnen. Ich habe sehr früh auf die Gefahr hingewiesen, dass Energieressourcen sich zur entscheidenden Machtwährung in den internationalen Beziehungen entwickeln. Außen- und Sicherheitspolitik muss diese Gefahr in den Blick nehmen, und mit Europa haben wir dafür ein Instrument.
Wir orientieren uns dabei an den Prinzipien Verlässlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit. Beim Frühjahrsgipfel im März wollen wir einen europäischen Aktionsplan für eine gemeinsame Energiepolitik verabschieden.
Das Verhältnis von Energieliefer-Ländern, Transitländern und Konsumentenländern wird dort und in der G8-Agenda eine entscheidende Rolle spielen. Dieses Verhältnis müssen wir gestalten. Gestalten heißt dabei mehr als nur Resolutionen zu fassen, etwa zur Energiecharta – dies schafft gutes Gewissen, wird aber nicht reichen.
Natürlich würde ich es begrüßen, wenn Russland die Europäische Energiecharta ratifiziert. Einen Sack voll Aufrufe und Presseerklärungen dazu gibt es. Aber wie realistisch ist das, wenn auch das Erzeugerland Norwegen, unser enger, demokratischer, zuverlässiger Partner und Freund, diese Energiecharta nicht zeichnet? Ich meine: Wenn die Zeichnung der Charta kurzfristig nicht erreichbar ist, müssen wir dann wenigstens die wichtigsten Elemente davon mit Leben erfüllen: Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit, Transparenz und Umweltverträglichkeit hatte ich schon genannt. Dabei sind wir seit Petersburg auf einem hoffnungsvollen Weg!
Besonders Gewicht in der Energiepolitik haben für uns erneuerbare Energien und das Thema Energieeffizienz. Je weniger Energie wir importieren müssen, desto besser für die Menschen und die Wirtschaft. Zugleich sind moderne Umwelttechnologien ein Wachstumsmotor und Exportschlager. Wir haben hier etwas zu bieten.
In der Energiepolitik müssen wir aber noch viel weiter über den Tag hinaus denken, als wir das bislang tun. Natürlich ist es sehr wichtig, unseren Anteil an den fossilen Energieträgern zu sichern, den wir brauchen. Aber alle diese Energieträger gehen irgendwann zur Neige. Weil die chemische und pharmazeutische Industrie auf fossile Grundstoffe angewiesen sind und wir Bürger auf daraus entstehende Produkte noch mehr, dürfen wir Öl schon deshalb nicht einfach bis zum letzten Tropfen aus der Erde pumpen. Wir brauchen – und davon bin ich überzeugt, und ich kenne die gängigen Gegenargumente – also zum Beispiel die Wasserstoff-Technologie als Energieträger und vielseitigen Grundstoff – je früher, desto besser. Eine energische europäische Anstrengung dazu ist überfällig.
Die globalen Entwicklungen vom Terrorismus über zerfallende Staaten bis zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zeigen: Kein Staat in Europa kann mehr allein für seine Sicherheit sorgen. Unsere Außenpolitik muss deshalb darauf zielen, das europäische Modell des Zusammenwachsens, das Modell von Sicherheit und Stabilität, auf die Regionen in der Nachbarschaft zu Europa auszudehnen. Politischer Dialog, wirtschaftliche Verflechtung und eine konkrete Zukunftsperspektive für die Menschen – diese Prinzipien können Vorbild für die Gebiete an der östlichen EU-Grenze, für den Nahen Osten und für den Mittelmeerraum sein.
Ich plädiere auch für eine Partnerschaft mit Russland. Das nächste Jahr bietet ein „window of opportunity“, um Russland langfristig unumkehrbar an Europa zu binden. Denn das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Russland läuft 2007 aus und muss neu verhandelt werden. Wenn beide Seiten diese Chance ergreifen, bietet das ungeheure Perspektiven. Mittelfristig könnten eine Freihandelszone, eine umfassende Energiepartnerschaft, visafreie Verkehr und eine breite Vernetzung in der Forschung, Bildung und Kultur möglich werden.
Zu den noch unklaren Grenzen Europas und der künftigen Erweiterung sage ich: Bulgarien und Rumänien werden sicher nicht die letzten Staaten sein, die der EU beitreten. Aber der Weg bis zur Mitgliedschaft wird für neue Interessenten zum Teil länger und steiniger werden als erhofft.
Kroatien hat Chancen, in absehbarer Zeit zur EU zu stoßen, muss aber gerade im Bereich der Rechtssicherheit noch erhebliche Defizite beseitigen. Die Türkei hat Anspruch auf faire Beitrittsverhandlungen. Es ist eine Schlüsselfrage für Europa, ob die Türkei sich dauerhaft zu Europa und seinen Werten bekennt. Ich wünsche mir, dass die Türkei in diesem Jahrhundert als Brücke zu den Nachbarregionen Europas fungiert und nicht als Bollwerk zwischen Europa und den islamischen Ländern im Mittleren Osten.
Darum kritisiere ich die kontraproduktiven Störmanöver aus der EU, besonders auch Deutschland. Manche Politiker in der CDU und CSU lassen die Türkei immer wieder spüren, dass sie in der EU nicht willkommen sei. Solche Sprüche mögen in bayerischen und anderen Bierzelten einen schnellen Applaus wert sein, für die Zukunft Europas sind sie wenig verantwortlich.
Was manche westeuropäische Konservative gerne ausblenden, ist doch: Auch aus türkischer Sicht erfordert das langfristige Bekenntnis zu Europa erheblichen innenpolitischen Mut – siehe die Zypern-Frage. Ich fordere die Türkei allerdings auf, diesen Mut jetzt aufzubringen und der Aufnahme Zyperns in die Zollunion bis zum Jahresende zuzustimmen. Das ist das entscheidende Signal, damit Europa und die Türkei weiter zielstrebig aufeinander zugehen. Vieles würde einfacher, davon bin ich überzeugt, wenn Zypern umgekehrt seine Blockade gegen den – von der EU 2004 versprochenen – Direkthandel Nordzyperns mit der EU aufgeben würde.
Langfristig ist das Thema einer EU mit mehr als 30 Mitgliedern nicht vom Tisch. Wer Stabilität auf dem westlichen Balkan erhalten, wer Rückschläge in die Konflikte der 90er Jahre verhindern will, der muss die europäische Perspektive für die Region erhalten. Wichtig ist jedoch: Diese Perspektive muss nicht in jedem Fall in einer Vollmitgliedschaft für jeden münden.
Stabile Verhältnisse sind auch in jener Nachbarschaft von europäischem Interesse, in der eine EU-Mitgliedschaft nicht in Sicht ist, also jenseits der heutigen EU-Ostgrenzen. Wir dürfen die Kräfte, die sich in diesen Ländern für Demokratie und Marktwirtschaft einsetzen, nicht enttäuschen. Dafür brauchen wir in der EU attraktive und glaubwürdige Angebote.
Im Herbst wird die Europäische Kommission einen Bericht zur Nachbarschaftspolitik vorlegen. Die Bundesregierung wird im Dezember vom Europäischen Rat den Auftrag erhalten, die Nachbarschaftspolitik während unserer Präsidentschaft fortzuentwickeln, attraktiver für die Nachbarn und damit zukunftstauglicher zu machen. Darauf bereiten wir uns vor!
Im Juni 2007 findet dann in Brüssel der Europäische Rat statt, der sich mit der Frage beschäftigen wird, ob und wie in das Projekt „Europäische Verfassung“ wieder Leben kommt. Jeder hier kennt die verfahrene Lage nach den verlorenen Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden.
Der luxemburgische Premierminister Jean-Claude Juncker hat kürzlich bei der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt ungeschminkt von einer „Krise“ gesprochen, in der sich Europa befinde. Ich schließe mich diesem Urteil an. Die Bevölkerung in Europa sei in der Frage der europäischen Integration „tief gespalten“, so Juncker. Die einen wollten mehr Europa, die anderen fänden, dass es heute schon zu viel Europa gebe.
Die zutreffende Einschätzung von Jean-Claude Juncker zeigt, wie schwierig die Aufgabe ist, die auf die deutsche Präsidentschaft zukommt. Unsere Haltung ist klar: Wir stehen zum Verfassungsvertrag und wollen ihn in seiner politischen Substanz erhalten. Aber in unserer Präsidentschafts- und Vermittlerrolle tun wir gut daran, erst einmal zuzuhören, bevor wir einen Vorschlag zum weiteren Verfahren formulieren, der als Kompromiss von hoffentlich allen Partnern mitgetragen wird.
In einem Punkt möchte ich das Visier jedoch schon ein Stück herunterlassen. Die Verfassung ist zwar in zwei EU-Staaten gescheitert, und mehrere andere haben daraufhin die Ratifizierung ausgesetzt. Aber Fakt ist ebenso, dass 15 von 25 Mitgliedstaaten dem Verfassungsvertrag bereits zugestimmt haben, auch der Bundestag und Bundesrat; Finnland wird in diesem Jahr nachfolgen; für Bulgarien und Rumänien ist die Verfassung schon Bestandteil des Beitritts. Mit anderen Worten: Zwei Drittel der Mitgliedsstaaten stehen zu jener Verfassung, an deren Ausarbeitung alle gleichberechtigt teilgenommen haben.
Ich meine: Daraus erwächst eine Verpflichtung für alle. Wenn die Verfassung gerettet werden soll – und wir brauchen sie dringend – dann bedeutet das: Alle müssen sich bewegen. Aber einige müssen sich mehr bewegen als andere.
Ich habe den Eindruck, dass sich die Regierungen in Europa ihrer Verantwortung bewusst sind. So deute ich einige jüngste Äußerungen zum Beispiel aus Polen. Die Argumente für die Europäische Verfassung sind nach wie vor überzeugend: Die Verfassung macht die EU demokratischer, transparenter und effizienter. Sie erhöht die Schlagkraft der EU in der Außenpolitik, die wir täglich dringender brauchen, wie die Konflikte im Nahen Osten, mit dem Iran oder in Afrika zeigen. Die Verfassung führt zu einer schnelleren und verlässlicheren Meinungsbildung in der EU. Sie beseitigt viele Defizite, die die Europaskeptiker beklagen.
Die Aufgabe bleibt: Wir müssen die EU institutionell in die Lage versetzen, ihre Aufgaben effizient zu lösen. Mit 27 Mitgliedstaaten braucht die EU andere Strukturen als mit 12 oder 15. Wer sich dagegen sperrt, schwächt die EU und schadet damit indirekt auch seinen eigenen nationalen Interessen.
Ich will vor übertriebenen Erwartungen warnen: Am Ende der deutschen Präsidentschaft wird kein endgültiges Ergebnis stehen, sondern – wenn es gut läuft – eine Entscheidung, dass die Anstrengung um die Verfassung fortgeführt wird, verbunden mit einem Beschluss zu den Modalitäten und Zeitplänen. Unser Ziel ist trotzdem ehrgeizig: Wir brauchen keinen Formelkompromiss, sondern eine Lösung, die Europa arbeits- und zukunftsfähig macht.
Europa hat uns für unsere EU-Präsidentschaft ein ziemlich schweres Bündel aufgeladen. Und die aktuellen Entwicklungen, die in jeder Präsidentschaft für zusätzlichen Wirbel sorgen – wie der ukrainische Gas-Streit für Österreich oder gerade der Libanon-Konflikt für die Finnen – kennen wir noch überhaupt nicht. Ich registriere die intensiven Hoffnungen und Erwartungen unserer EU-Partner, die an uns gerichtet werden. Meine Bitte lautet deshalb: Bleibt realistisch in dem, was ihr von Deutschland während seiner Präsidentschaft fordert.
Wir gehen konzentriert, gut vorbereitet und zuversichtlich an unsere Aufgabe. Wenn wir den Menschen Optimismus und Vertrauen in Europa vermitteln wollen, müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Bestimmt ist der 25. März 2007, der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, ein gutes Datum, um diesen Optimismus zu bekräftigen. An diesem Tag werden wir in Berlin feierlich die große Erfolgsgeschichte unseres Kontinents würdigen.
Ich wünsche mir, dass wir aus der Stimmung dieses Tages die Kraft entwickeln, auch die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Gemeinsam haben wir Europäer die Kraft, unser Schicksal und unsere Zukunft zu gestalten.
Wir jedenfalls können den Europäern gerade eine schöne Geschichte erzählen, was alles möglich wird, wenn eine Mannschaft ihren Teamgeist entdeckt. Ich meine die Geschichte unserer Fußball-Nationalmannschaft. Zwischen dem Fiasko von Florenz – dem 1:4 gegen Italien – und den begeisternden Spielen bei der WM lagen nur 100 Tage. Ich wünsche mir, dass wir in Europa mit derselben Leidenschaft auf unser gemeinsames Ziel hin arbeiten. Der Geist der WM 2006 im Saal der EU-Regierungschef – dann bin ich sicher, dass Europa gelingt.