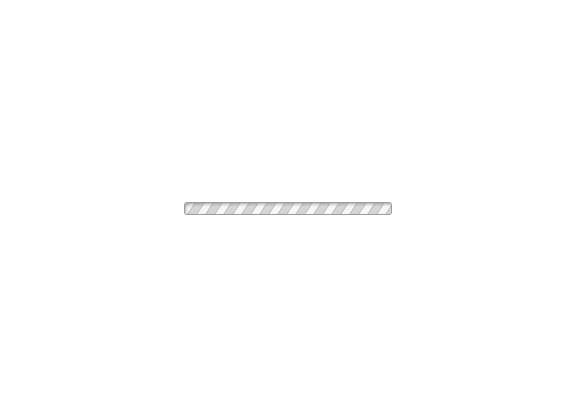Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Europa neu denken“ - Rede von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier
Die Einigung Europas ist eine Vision, die besonders jüngere Menschen immer wieder aufs Neue fasziniert. Tobias Bütow und Mirco Günter haben uns das gerade eindrucksvoll demonstriert. Sie beide zeigen uns stellvertretend für viele junge Menschen, wie viel Anziehungskraft das „Projekt Europa“ immer noch entfaltet.
Heinz Schwarzkopf hätte daran seine Freude, da bin ich mir sicher. Er verspürte in seiner Jugend dieselbe Leidenschaft und Tatkraft für das „Projekt Europa“. Darum gründete er vor 35 Jahren diese Stiftung. Seit dreieinhalb Jahrzehnten bringt die Heinz-Schwarzkopf-Stiftung junge Menschen in Europa in Kontakt miteinander. Sie fördert engagierte Schüler und Studenten und ermöglicht jungen Menschen, dass sie ihre Gemeinsamkeiten über Grenzen hinweg erkennen.
Warum ich das für so wichtig halte? Weil jede politische Idee, die von Dauer sein soll, sich beständig erneuern und neue Wurzeln schlagen muss. Die Heinz-Schwarzkopf-Stiftung hilft, unseren Garten Europa zu bewässern und zu pflegen. Darum habe ich auch gerne die Einladung von André Schmitz-Schwarzkopf angenommen, bei der heutigen Feier den Festvortrag zu halten. Ich möchte Ihnen zu Ihrer Arbeit gratulieren und Sie ermutigen, Ihre Arbeit so dynamisch fortzusetzen.
Denn die ansteckende Fröhlichkeit bei europäischen Jugendzeltlagern oder im Weinkeller nach einem europäischen Seminartag ist das Eine. Die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung zu Europa ist deutlich schlechter. Seien wir ehrlich: Die Europäische Union ist zwar die größte politische Erfolgsgeschichte der vergangenen 50 Jahre - aber sie befindet sich heute in einer schwierigen Phase. Das Projekt einer gemeinsamen Verfassung ist nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden ins Stocken geraten. Wir alle spüren, wie die Vorbehalte gegen die EU in der Bevölkerung wachsen. Die meisten Menschen fühlen ein Unbehagen darüber, wie europäische Politik aus dem fernen Brüssel immer stärker in ihr Alltagsleben eingreift.
Ich habe mich oft gefragt, was wohl ein Friseurmeister oder eine Verkäuferin denkt, wenn sie im Fernsehen die gigantischen Bürokomplexe der EU-Kommission und die schwer verständlichen Berichte sehen. Viele Menschen glauben, dass kaum einer in Brüssel die Lebensumstände der ganz normalen Leute wirklich kennt und in die Entscheidungen einbezieht. Brüssel ergeht es da übrigens nicht anders als den meisten nationalen Regierungen. Die rasanten Veränderungen und die Globalisierung der Wirtschaft verunsichern die Menschen. Viele fürchten, dass sie zu den Verlierern des Wandels gehören. Sie fürchten auch, dass die Politik sie gegen die Interessen der Wirtschaft nicht mehr schützen kann. Manche resignieren vor einer Politik, die sie nicht verstehen - und von der sie das Gefühl haben, dass sie ihnen niemand erklärt.
Aber für die Zukunft Europas ist das Misstrauen der Menschen besonders gefährlich. Denn die Einigung Europas war deswegen so populär, weil die Menschen sich von offenen Grenzen einen persönlichen Vorteil versprachen. In Zeiten der Globalisierung wünscht sich mancher, dessen Arbeitsplatz vielleicht bald auch ins Ausland verlegt wird, einen Schutzzaun zurück. Wer nicht so flexibel, mobil und top-ausgebildet ist, empfindet Europa oft nicht mehr als Zukunftsversprechen, sondern als Bedrohung. Ich spreche diese Dinge so klar an, weil es nichts hilft, die Lage schön zu reden. Nur wenn wir die Situation ehrlich beschreiben und analysieren, können wir das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen und Wege finden, die aus der Situation herausführen. Politik beginnt damit, auszusprechen, was ist.
Wir müssen die ganz unterschiedlichen Bedenken der Menschen mit Blick auf Europa ernst nehmen und dürfen sie nicht beiseite wischen. Gerade weil ich die weitere Einigung Europas will, sage ich: Die Politik muss den Menschen mehr zuhören, die Diskussion suchen und europäische Maßnahmen genauer erklären. Demokratische Politik braucht die Unterstützung der Menschen. Das bedeutet aber keineswegs, dass man jedem nach dem Munde redet! Lassen Sie uns darum den Versuch machen, einige der Einwände und Bedenken der Reihe nach durchzugehen.
Viele Bürgerinnen und Bürger fragen zum Beispiel, ob wir immer weitere zusätzliche Aufgaben auf die europäische Ebene übertragen sollen. Ich sage: Recht haben sie mit ihrer Frage! Die europäische Integration hat heute ein sehr hohes Niveau erreicht. Es geht nicht mehr darum, dass wir einen Krieg zwischen Franzosen, Deutschen und anderen Nationen verhindern. Heute verhandeln wir in Brüssel über Alltagsprobleme, die früher zum Kern von nationaler Innenpolitik gehörten. Im Extremfall entscheidet heute ein 30jähriger Grieche in Brüssel darüber, ob ein mittelständischer Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern eine staatliche Subvention bekommen kann oder nicht.
Das ist keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines EU-Mitgliedsstaates mehr. Alle EU-Länder haben ihre nationalen Rechte freiwillig abgetreten. Aber das bedeutet nicht, dass die EU-Kommission jede Grauzone nutzen sollte, um sich weitere Zuständigkeiten in beinahe jedem Randbereich zu erobern.
Denn diesen Ruf kann inzwischen niemand mehr überhören: Überall in Europa verlangen die Menschen mehr Respekt vor ihren jeweiligen nationalen Identitäten. Die kulturelle Vielfalt in Europa ist ein großer Schatz. Wir dürfen ihn nicht durch Gleichmacherei zerstören. Wir müssen darum noch deutlicher machen, welche Zuständigkeiten auch in Zukunft eindeutig bei den Nationalstaaten verbleiben. Dazu zähle ich zum Beispiel die Sozialsysteme.
Viele Menschen in Deutschland fürchten, dass die sogenannte „Harmonisierung“ auch bei der Rente und der Gesundheitsversorgung zuschlägt und die Sozialniveaus etwa von Deutschland und Polen auf der Hälfte angeglichen werden könnten. Diese Furcht ist nach den EU-Verträgen unbegründet. Aber wir müssen dies den Menschen viel deutlicher sagen!
Außerdem stören sich viele Bürger daran, dass sie häufig nicht erkennen können, wer für Entscheidungen in der EU verantwortlich ist und wie sie zustande kommen. Nun ist der Interessenausgleich in einer Union mit 25 Mitgliedstaaten keine einfache Sache. Dennoch kann ich das Unbehagen vieler Bürger verstehen. In dem Labyrinth in Brüssel, in dem EU-Richtlinien und Verordnungen ausgebrütet werden, finden sich nur ausgewiesene Spezialisten zurecht. Das schafft Misstrauen bei den Bürgern. Wir kennen das doch von uns selbst: Wer nicht verständlich sagen kann oder will, was er beabsichtigt oder plant, von dem vermuten wir, dass er wahrscheinlich etwas verbergen möchte.
Lassen Sie uns deshalb ganz nüchtern feststellen: An der Art und Weise, wie die Brüsseler Institutionen funktionieren, muss manches verbessert werden. Europa muss in Zukunft durchschaubarer und verständlicher werden. Darum brauchen wir die Verfassung - je eher, desto besser. Das Verfassungsprojekt muss im nächsten Jahr unter der deutschen Ratspräsidentschaft wiederaufgenommen werden.
Viele Menschen fühlen sich von der EU sogar ganz existentiell bedroht. Besonders in den einfachen Fertigungsbranchen haben viele Firmen ihre Arbeitsplätze nach Osteuropa verlagert. Andere schüchtern die Belegschaft mit der Drohung ein, nach Osteuropa zu ziehen, selbst dann, wenn die Betriebe schwarze Zahlen schreiben. Gleichzeitig drängen aus der anderen Richtung preiswerte Arbeitnehmer auf den deutschen Markt. Handwerker und Baufirmen klagen über ausländische Billigkonkurrenz, die bei uns die Preise kaputtmacht. Wer hier in Berlin eine Wohnung tapezieren oder eine Wand versetzen muss, der weiß: Am günstigsten geht das mit einem Osteuropäer.
Aber hier sage ich: Stop! Denn die EU-Osterweiterung ist gerade für Deutschland per Saldo eine Erfolgsgeschichte. Bei den Klagen über den sprichwörtlichen „polnischen Klempner“ halte ich dagegen. Europa hat mit den Beitrittsstaaten im Osten ein dynamisches Wirtschaftsgebiet hinzugewonnen. Wir brauchen doch bloß 80 Kilometer von hier Richtung Osten zu schauen! Jeden Tag stehen die Lastwagen an der Grenze zu Polen in langen Warteschlangen. Sie alle haben Waren aus Deutschland dabei, die hier bei uns hergestellt, umgeschlagen und verpackt worden sind.
Für viele Firmen in Deutschland, angefangen beim Maschinenbau, ist ein neuer Wachstumsmarkt entstanden. Wenn Polen, Ungarn, Tschechen und Slowenen sich ihren Wohlstand aufbauen, sichert und schafft das unzählige Arbeitsplätze bei uns in Deutschland.
Darum möchte ich auch ein klares Plädoyer gegen die Klagen vom deutschen Nettozahler halten. Europa macht uns Deutsche nicht arm. Im Gegenteil: Wir verdanken unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze ganz wesentlich dem Umstand, dass wir unsere Waren in 25 EU-Ländern ohne Zölle und Grenzzäune verkaufen können. Wir reden oft davon, dass Deutschland „Exportweltmeister“ ist. Das klingt, als ob wir unsere Autos, Maschinen und anderen Produkte vor allem in den USA oder in Asien auf den Markt bringen. Aber dieser Eindruck ist falsch: fast zwei Drittel der deutschen Exporte verkaufen wir bei unseren Partnern in der EU. Der Deutsche Industrie- und Handelstag hat nachgerechnet. Er sagt: Die freien Grenzen für Waren und Produkte in der EU sichern 5,5 Millionen Arbeitsplätze bei uns in Deutschland.
Nicht jede euroskeptische Parole, auch wenn sie für einen kurzen Moment einleuchtend klingt, ist stichhaltig. Manche Populisten behaupten, dass Europa die Menschen arm macht und nur die Großkonzerne begünstigt. Wer so redet, kann nicht bei Trost sein! Schauen wir uns die Entwicklung von Ländern an, die der EU vor 20 Jahren beigetreten sind. Spanien hatte 1986 eine Arbeitslosigkeit von 23 Prozent, heute liegt sie deutlich unter zehn Prozent. Seit Irland in der EU ist, wandern die Menschen dort nicht mehr wie seit Jahrhunderten aus. Jeder, der will, findet dort jetzt einen Job, Irland ist sogar zum Magneten für arbeitswillige Einwanderer geworden. Und es gibt inzwischen sogar Unternehmen und Handwerker aus Deutschland, die in Irland mit Arbeitskräften von hier gut gehende Filialen betreiben.
Ich unterstreiche deshalb: Der europäische Binnenmarkt ist insgesamt ein Wachstumsmotor für Wohlstand und Arbeitsplätze. Wer in Europa eine Idee hat, wer ein neues Produkt erfindet, kann es auf einem Markt von 450 Millionen Menschen ohne Hindernisse anbieten. So eine Chance gibt es sonst kaum auf der Welt.
Auch die Einführung des Euro nutzt uns allen. Wir haben damit eine einheitliche Währung für 300 Millionen Menschen geschaffen. Davon profitieren Verbraucher wie Unternehmen, auch wenn die Pizza oder das Wiener Schnitzel im Restaurant teurer geworden sind. Insgesamt aber behält das Geld seinen Wert: Die Inflation - das ist die wichtigste Rechengröße gerade für die Menschen mit kleinen und normalen Einkommen - hat sich in Deutschland seit der Euro-Einführung auf 1,3 Prozent halbiert. Betriebe können jetzt im Euro-Raum in einer einzigen Währung abrechnen und brauchen keine Wechselkurse mehr abzusichern. Der Bundesverband der Deutschen Industrie schätzt, dass die Unternehmen in Deutschland deswegen rund zehn Milliarden Euro pro Jahr sparen.
Bei allen Erfolgen im wirtschaftlichen Bereich gilt auch: Wir reden in Europa zuwenig über die anderen Fragen. Europa ist mehr als ein gemeinsamer Markt. Europa ist auch ein Gesellschaftsmodell, das sich von den Modellen in den USA und Asien unterscheidet. Die große Mehrheit der Menschen in Europa ist stolz auf den sozialen Ausgleich in unserer Wettbewerbsgesellschaft, wie wir sie in Europa praktizieren. Die Menschen wollen ein soziales Europa, das auch unser Verständnis von Freiheit und Toleranz hochhält. Diese Punkte haben wir in den vergangenen Jahren nicht deutlich genug herausgestellt.
Eine andere These, die ich immer wieder höre, lautet: Die offenen Grenzen sind eine Bedrohung für unsere Sicherheit. In der EU stünden auch die Tore für organisierte Kriminalität und Terrorismus sperrangelweit offen.
Auch hier sage ich: Einspruch! Menschenschieber, Drogenhändler und Terroristen lassen sich von Schlagbäumen und Grenzschildern schon lange nicht mehr abschrecken. Aber in der EU funktioniert die Gegenwehr des Staates immer besser. Wir alle können uns noch gut daran erinnern, wie Polizeibehörden und Nachrichtendienste in Europa ihre Erkenntnisse und Computerdaten voreinander versteckt haben. Diese Zeiten sind vorbei! Die Sicherheitsbehörden in der EU haben sich eng miteinander vernetzt. Und diese Zusammenarbeit hat dazu geführt, dass in mehreren Fällen Terrorpläne verhindert werden konnten.
Nach den Anschlägen in Madrid oder London ist es gelungen, die Attentäter und Drahtzieher schnell zu identifizieren und festzunehmen. All dies wäre in einem Europa mit inneren Grenzen so nicht möglich.
Wir sollten uns vergegenwärtigen: Ohne die EU würden wir in Deutschland heute unsicherer leben.
Wieder andere sagen: Die Europäer, die EU, die kriegen es einfach nicht hin. In diesem zerstrittenen Haufen kommt nichts voran. Solche Kritiker halten uns gerne zum Vergleich die USA vor: Washington sei doch die einzige Weltmacht, die mit militärischer Schlagkraft und politischer Stärke rasch in jeden Konflikt eingreifen kann. Sie raten uns: Verzichtet gleich ganz auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, anstatt euch ständig nur ergebnislos zu streiten.
Das ist keine Diskussion, die in erster Linie von Facharbeitern oder dem Mann auf der Straße geführt wird. Hier melden sich eher die außen- und sicherheitspolitischen Eliten zu Wort.
Aber dennoch ist diese Debatte wichtig für die Zukunft Europas. Denn es stimmt ja: Wenn 25 EU-Länder außenpolitisch gemeinsam vorgehen wollen, ist dies meistens schwierig. Jedes Land hat seine Geschichte, seine Traditionen und Empfindlichkeiten. Die lassen sich nicht einfach beiseite schieben. Und auch die Instrumente der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in der EU sind verbesserungsfähig. Viele dieser Punkte sind im Verfassungsvertrag aufgegriffen. Auch deshalb brauchen wir ihn.
Die EU hat aber schon in den vergangenen Jahren ihre Außenpolitik mit Lichtgeschwindigkeit weiterentwickelt und insbesondere auch die Lehre aus den Kriegen auf dem Balkan gezogen. Wir Europäer engagieren uns in zahlreichen Ländern im Rahmen von Friedensmissionen, politisch und militärisch. Die EU sichert heute den Frieden in Bosnien, im Kosovo und in Mazedonien, aber auch außerhalb Europas. Denken Sie an die EU-Missionen in der indonesischen Provinz Aceh oder im Kongo.
Und eine besonders wichtige Aufgabe erwartet uns jetzt im Libanon. Europa beteiligt sich mit etwa 7000 Soldaten an der internationalen Friedenstruppe. Wir wollen damit zeigen: Bei der Suche nach einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten ist die EU ein wichtiger und zuverlässiger Partner.
Wir müssen in der Öffentlichkeit noch etwas deutlicher darauf hinweisen: Die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik wird im 21. Jahrhundert immer wichtiger. Wir können nicht einfach eine Grenze um die EU ziehen und sagen: Bei uns schießen wir nicht aufeinander, und der Rest der Welt geht uns nichts an. Dazu ist die gesamte Welt längst viel zu sehr zusammengewachsen. Wir haben das gerade wieder erst erlebt: Wenn im Nahen Osten ein Krieg ausbricht, wächst die Terrorgefahr auch in den Regionalzügen bei uns.
Dies ist ein weiterer Grund, jenseits der moralischen und politischen Verpflichtungen, die wir fühlen.Wir werden den Frieden bei uns in Europa also auf Dauer nur sichern, wenn auch unsere Nachbarn in Stabilität, Demokratie und Rechtsstaat leben.
Darum kümmern wir uns in der EU so intensiv darum, die Stabilität in Südost- und Osteuropa zu festigen, aber auch im Nahen Osten und rund um das Mittelmeer. Dabei verfolgt die EU einen eigenen Weg.
Meine Überzeugung ist klar und einfach. Die Probleme des 21. Jahrhunderts vom internationalen Terrorismus bis zum Zerfall ganzer Staaten lassen sich mit noch so beeindruckenden Waffenarsenalen nicht lösen. Überall auf der Welt entsteht dauerhafter Frieden nur, wenn die Menschen Vorurteile und Hass überwinden und beginnen, miteinander zu arbeiten und zu leben. Das hat die EU in den vergangenen 50 Jahren vorgemacht.
Unsere Botschaft an die unruhigen Regionen der Welt lautet: Reden statt schießen! Das ist unser wichtigster politischer Exportartikel in der EU. Deshalb stehen Bundeswehrsoldaten seit mehr als zehn Jahren auf dem Balkan. Und darum engagieren wir uns auch langfristig in Afghanistan - nicht nur mit der Bundeswehr, sondern mit Entwicklungshelfern, Lehrern und Regierungsberatern. Auch im Nahen Osten setze ich auf eine kluge Mischung von politischen Verhandlungen, militärischer Absicherung und ganz praktischen Hilfen für das alltägliche Zusammenwachsen und die Überwindung der humanitären Krise.
Schritt für Schritt ist die EU auf 25 Länder angewachsen. Die beständige Erweiterung hat dazu beigetragen, die Teilung Europas zu überwinden. Sie hat langfristige Stabilität für Europa gebracht und dafür gesorgt, dass sich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und marktwirtschaftliche Strukturen überall in Europa ausbreiten konnten.
Jetzt stehen wir vor der Frage, wie weit die EU sich über die bestehenden Grenzen ausdehnen kann, ohne dass sie ihren inneren Zusammenhalt verliert. Diese Frage wird derzeit unter finnischer Präsidentschaft diskutiert. Bis wir sie gemeinsam lösen, wird noch einige Zeit vergehen.
Rumänien und Bulgarien werden 2007 nicht die letzten Staaten sein, die der EU beitreten - so viel ist sicher. Aber der Weg für neue Interessenten bis zur Mitgliedschaft wird manchmal länger und steiniger werden als erhofft.
Die EU wird ihre Zusagen einhalten. Gleichzeitig soll sich aber niemand täuschen: Die Kriterien, die die EU für die diesen Prozess festgelegt hat, müssen rigoros angewandt werden. Darüber hinaus müssen wir klar sagen: Nicht jedes Land, das sich Hoffnungen macht, in die EU zu gelangen, wird am Ende als Vollmitglied aufgenommen werden können. Aber dennoch dürfen wir die Kräfte, die sich in diesen Ländern für Demokratie und Marktwirtschaft einsetzen, nicht enttäuschen. Darum brauchen wir in der EU attraktive und glaubwürdige Angebote an unsere Nachbarn, die mutig einen häufig schmerzhaften Reformprozess begonnen haben.
Die EU braucht - nehmen Sie das Wort nicht so groß, wie es jetzt klingt - eine Neuformulierung ihrer Ostpolitik! Wir arbeiten bereits daran. Im Herbst wird die Europäische Kommission einen Bericht zur Nachbarschaftspolitik vorlegen. Die Bundesregierung will, dass der Europäische Rat uns im Dezember ein Mandat erteilt, dass wir die Nachbarschaftspolitik unter deutscher EU-Präsidentschaft im kommenden Jahr weiter entwickeln und intensivieren.
Wer mit den Menschen in Deutschland spricht, der weiß, dass eine deutliche Mehrheit dem europäischen Projekt - trotz mancher Skepsis - weiterhin positiv gegenüber steht. Das gleiche gilt übrigens auch für die Mehrheit der Europäer insgesamt. Doch die Fragen und Befürchtungen, die ich angesprochen habe, sie spielen für die Bürgerinnen und Bürger eine erhebliche Rolle. Und sie verlangen sehr genaue Antworten, auch auf die grundsätzliche Frage, warum und wozu wir die EU brauchen.
Die Politik muss sich selbstkritische Fragen stellen. Die Argumente aus der Gründungsphase der EU reichen zu Beginn des 21. Jahrhunderts einfach nicht mehr aus. Die Generation von Heinz Schwarzkopf, sie hatte noch ein klares Ziel vor Augen. In den Schützengräben und in den Trümmerwüsten des Zweiten Weltkriegs entstand ein unbändiger Wille, dass sich so ein Gemetzel nie wiederholen dürfe.
So kamen die Völkerverständigung und europäische Einigung in Gang. Das Lebenswerk von Heinz Schwarzkopf und die Arbeit der von ihm gegründeten Stiftung stehen stellvertretend für die Leistung dieser Generation. Sie hat Europa und Deutschland mit unglaublichem Fleiß und Einsatz wieder aufgebaut. Das meine ich materiell, aber auch in einem geistigen Sinn. Ich finde, dafür sollten wir alle der Generation unserer Eltern noch lange dankbar sein.
Am 25. März 2007 - während der deutschen EU-Präsidentschaft - sind es genau 50 Jahre her, dass die Römischen Verträge unterzeichnet wurden. Der Rückblick auf diese Zeit offenbart eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir erleben die friedlichste Periode in Europa seit Bestehen dieses Kontinents. Die Gefahren von Krieg, Vertreibung und Hunger sind praktisch überwunden. Wir genießen Frieden, Stabilität und Wohlstand auf einem Niveau wie keine Generation vor uns.
Und doch sind diese einmaligen Lebensumstände gerade für die Jüngeren schon selbstverständlich geworden. Vor 40 Jahren, zu den Zeiten von Adenauer und de Gaulle, war ein Jugendaustausch zwischen Deutschen und Franzosen noch eine Top-Nachricht. Wer von den Jüngeren hier im Saal kann sich das heute noch vorstellen? Sogar die Berliner Mauer kennen manche inzwischen nur noch von Erzählungen.
Jetzt stehen wir vor einer neuen Epoche: dem Zeitalter der Wissensgesellschaft, der globalisierten Wirtschaft, geprägt vom Internet, von knappen Rohstoffen und wachsenden Umweltbelastungen. Deshalb reichen die alten Denkmuster auch nicht mehr, um die Menschen für Europa zu begeistern.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Perspektivwechsel brauchen, wenn das „Projekt Europa“ für die Menschen wieder Attraktivität ausstrahlen soll.
Vor dieser Kulisse müssen wir Europa neu begründen. Europa muss heute nicht neu erfunden, aber neu gedacht werden. Was ist unser Ziel und unsere Aufgabe heute? Welche Gestalt soll Europa im Jahr 2030 annehmen? Welche Vision von Europa können wir jungen Menschen heute anbieten? Europa neu denken heißt auch, dass die Politik nicht so tun soll, als hätte sie bereits auf alle Fragen eine Antwort.
Auf einigen Grundlagen können wir dabei aufbauen. Europa ist eine Wertegemeinschaft, nicht nur ein Wirtschaftsraum. Wer das genau wissen will, braucht nur die Europäische Grundrechtecharta aus dem Jahre 2000 in die Hand zu nehmen. Sie garantiert jedem EU-Bürger Rechte, die für uns selbstverständlich klingen, es aber keineswegs sind: die unantastbare Würde des Menschen, das Recht auf Leben, das Verbot von Todesstrafe und Folter, die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Auf diesen Werten basiert das europäische Gesellschaftsmodell.
Wir Europäer stehen für eine Politik, die es jedem Einzelnen ermöglicht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und durch Leistung voranzukommen. Wir stehen auch dafür, dass Menschen sich auf die Solidarität der Gemeinschaft verlassen können, wenn sie in Not geraten. Wir wollen eine tolerante Gesellschaft, in der Menschen aller Hautfarben, Religionen und Neigungen miteinander leben. Wir fördern eine kinder- und familienfreundliche Arbeits- und Lebenswelt. Und Europa bedeutet auch, dass wir die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen als Reichtum begreifen, den wir sorgsam erhalten. „Einheit in Vielfalt“ - das ist und bleibt das richtige Motto für die EU.
Wer heute in der Europäischen Union jung ist, dem bieten sich Möglichkeiten, wie keiner Generation zuvor. Von Estland bis Portugal verbinden uns heute gemeinsame Chancen, ein gemeinsames Lebensgefühl, vielleicht sogar schon der „European Way of Life“. Die jüngeren Menschen - ich nenne sie die heutige „Generation Europa“ - haben allen Grund, selbstbewusst ihre Zukunft anzupacken und zu gestalten.
Der Rahmen für das Europa der Zukunft steht. Aber die Frage, welches Bild wir darin entwerfen, ist noch offen. Darum begreifen Sie es als Ermutigung: Denken wir Europa neu! Ich verstehe diesen Appell als Angebot an alle Menschen, die Zukunft Europas aktiv zu gestalten. Wir wissen doch alle, dass wir ohne dieses geeinte Europa schlechter leben würden. Suchen wir also gemeinsam die Chancen, die sich uns bieten. Krempeln wir die Ärmel auf wie einst die Generation von Heinz Schwarzkopf. Lassen Sie uns gemeinsam ringen um den besten Weg für Europa!