Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Europa-Staatsminister Michael Roth zum Thema „Europa in der Midlife-Crisis? Ideen für den nächsten Lebensabschnitt“
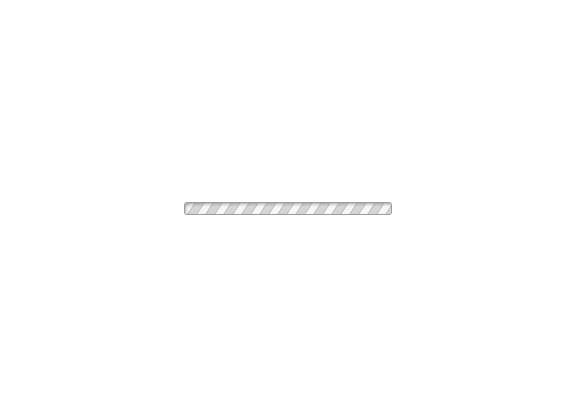
Vermutlich kennen Sie das oder haben schon mal davon gehört: Sie leben seit vielen Jahren zufrieden in einer festen Partnerschaft. Die berufliche Karriere läuft gut. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Die Wohnung ist fast abbezahlt. Und plötzlich verlieren Sie die Orientierung und fragen sich: War es das schon? Oder kommt da noch etwas?
Vielleicht läuft das mit Europa ja so ähnlich. Denn auch die EU steckt derzeit in einer handfesten Sinnkrise. Und man fragt sich ein wenig: Warum eigentlich? Denn im Grunde genommen könnte das vereinte Europa ziemlich stolz darauf sein, was es in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen hat: Frieden, Freiheit und Wohlstand für viele. Einheit in Vielfalt. Offene Grenzen und Freizügigkeit für Menschen von Portugal bis Polen, von Finnland bis Italien. Der größte Binnenmarkt und eine der drei Reservewährungen der Welt.
Man sollte meinen: Das kann sich sehen lassen! Aber trotz aller Erfolge der Vergangenheit kämpft die EU derzeit mit Selbstzweifeln, Unzufriedenheit und Zukunftsängsten. Nationalismus und Populismus drohen die EU von innen zu zersetzen. War es das also schon mit Europas besten Jahren?
Als Europäer, der mittlerweile seit über drei Jahrzehnten Europa bereist, erlebe ich diese Sinnkrise allerorten: Nicht nur in Brüssel, sondern auch in Budapest, Rom, Paris, Skopje oder Duisburg. Und das liegt wohl auch an uns selbst. Denn gerade auf dem Feld der Europapolitik hatte sich die neue Bundesregierung eine ganze Menge vorgenommen: Ein „neuer Aufbruch für Europa“ sollte her. Doch die Aufbruchstimmung währte nur kurz.
Die großen Vorhaben in der Europapolitik drohen in Berlin und Brüssel zerrieben zu werden. Die deutsche Antwort auf Emmanuel Macron ließ lange auf sich warten – und war dann für viele doch eher ein zaghaftes „Ja, aber“ als ein entschiedenes „Los geht’s!“.
Vor allem bei der jungen, europabegeisterten Generation spüre ich derzeit eine große Ernüchterung und Enttäuschung. Bei Europaveranstaltungen mit jungen Menschen hieß es für mich immer: Akkus aufladen. Hier habe ich das gefunden, was mir wirklich wichtig ist: die ungebremste Leidenschaft für Europa, die großen Träume ganz ohne Scheren im Kopf, den Mut und die Entschlossenheit zu Veränderung und Reform. Doch die Stimmung hat sich gewandelt: Heute schaue ich in viele skeptische Gesichter, die Fragen sind kritischer als früher.
Über Europa sind in den vergangenen Wochen und Monaten viele Reden gehalten worden. Und nun folgt auch noch eine von mir. Ich möchte heute Abend gerne meine ganz persönlichen Gedanken mit Ihnen teilen – frei von staatsministerlichen oder parteipolitischen Begrenzungen. Versprochen: Ich biete Ihnen heute 100 Prozent Michael Roth!
Ja, Europa steckt in einer Midlife-Crisis. Aber es ist eben kein hoffnungsloser Sorgenfall für die Therapeutencouch – sondern eher ein Kandidat für ein motivierendes Coaching. Stellen wir uns also vor, Europa wäre ein Mensch aus Fleisch und Blut und würde uns um ein paar Ratschläge für den nächsten Lebensabschnitt bitten. Dieses kleine Gedankenspiel will ich heute Abend gemeinsam mit Ihnen, Deniz Yücel und Almut Möller wagen. Danken möchte ich auch der Schwarzkopf-Stiftung und der Europäischen Bewegung Deutschland, die heute unsere Gastgeberinnen sind.
Europa hat seine besten Jahre noch vor sich. Wenn auf die zermürbende Phase der kritischen Selbstreflektion nun eine Phase der Selbstfindung und Neuorientierung folgt, dann ist mir um unser Europa nicht bange. Vier Ratschläge habe ich für meine alte Freundin Europa parat:
Erstens: Routinen durchbrechen – auch im Alter aktiv und in Bewegung bleiben.
Zweitens: Den Horizont erweitern – den Freundeskreis pflegen und ausbauen.
Drittens: Partnerinnen und Partner einbeziehen – einander zuhören und ernst nehmen.
Viertens: Den eigenen Prinzipien folgen – sich selbst treu bleiben und anständig miteinander umgehen.
Routinen durchbrechen – auch im Alter aktiv und in Bewegung bleiben.
Vorschlag: Neue Dynamik durch ein „Europa der Tempomacher“
Bewegung und Aktivität tun gut – erst recht in einer Lebenskrise. Sie machen den Kopf frei für kreative Lösungen und neue Wege. Doch an kraftvoller Dynamik hat es in der EU zuletzt gefehlt. Antriebslos und träge hat es sich Europa allzu sehr auf der Couch des Konsenses und der Einstimmigkeit gemütlich gemacht. Fortschritt? Fehlanzeige! Doch wer rastet, der rostet – das gilt erst recht für ein Europa, von dem alle erwarten, dass es endlich vorankommt und Ergebnisse liefert.
Auf der Bremse stehen dabei weniger die EU-Institutionen, sondern eine Reihe von Mitgliedstaaten, die ihr Heil lieber in nationalen Alleingängen suchen als an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. „Europe united“ – das ist und bleibt unser Ziel. Denn in den stürmischen Zeiten der Globalisierung, in dieser Welt voller Krisen und Konflikte, ist Europa immer noch unsere beste Lebensversicherung. Die derzeitigen Bewährungsproben sind lösbar – aber eben nur mit und niemals gegen Europa!
Doch so wünschenswert es auch ist, dass stets alle EU-Mitglieder an einem Strang ziehen: Wir werden nicht immer warten können, bis auch die allerletzten Zweifler und Kritikerinnen in der EU von einer Idee überzeugt sind.
Und ich mag mich auch nicht damit zufrieden geben, dass europäische Lösungen am Ende immer nur der kleinste gemeinsame Nenner sein müssen.
„Europe united“ ist gut und richtig. Aber wir brauchen jetzt Tempomacher, die bei immer mehr Projekten mutig voranschreiten – und die anderen Partner durch Erfolge überzeugen. Wenn gesamteuropäische Lösungen wenig ambitioniert bleiben oder gar nicht erst möglich sind, dann ist mir ein Europa der Tempomacher immer noch lieber als ein Europa des Stillstands.
Nein, es geht mir dabei mitnichten um die Verfestigung eines Kerneuropas. Denn machen wir uns nichts vor: Das „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“ ist doch längst Realität – denken wir nur an die Eurozone oder den Schengen-Raum. Verschiedene Geschwindigkeiten sind auch kein Drama – solange alle in dieselbe Richtung laufen. Die entsprechenden Instrumente sind ja in den EU-Verträgen angelegt – sie sind also kein Tabubruch, sondern vielmehr akzeptierte Politik.
Dabei ist die verstärkte Zusammenarbeit keine geschlossene Gesellschaft, sondern sie bleibt offen und dynamisch. Je nach Problemlage kann sie ganz unterschiedliche Gruppen von Mitgliedstaaten zusammenbringen. Es gibt sie in West und Ost, Nord und Süd. Damit neun Mitgliedstaaten – so viele Staaten müssen laut EU-Vertrag mindestens dabei sein – zusammenfinden, müssen wir alle flexibler agieren. Und wir müssen wieder lernen, den Kompromiss wertzuschätzen.
Die Tempomacher müssen jetzt den Turbo einlegen – und rasch gemeinsame Initiativen erarbeiten, denen dann auch konkrete Erfolgserlebnisse folgen. Mich ärgert es etwa, dass wir in den vergangenen Jahren bei der Einführung der Finanztransaktionssteuer nicht substanziell vorangekommen sind.
Gerade die Eurozone muss jetzt entschlossen vorangehen und ein Zeichen der politischen Handlungsfähigkeit setzen.
Wenn wir in der EU schon keinen Konsens mehr darüber finden, dass wir in einer „ever closer Union“ leben, dann sollten wir uns auf einen ambitionierten Zwischenschritt verständigen: eine „ever closer Eurozone“.
Der deutsch-französische Vorschlag für ein Eurozonen-Budget ist dafür ein hoffnungsvoller Startschuss. Doch das reicht nicht. Langfristig kann die Wirtschafts- und Währungsunion nur überleben, wenn sie auf dem Weg zu einer echten Sozialunion mutig voranschreitet.
Durch die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise haben die sozialen Verwerfungen dramatisch zugenommen. Mitten im Euro-Raum gibt es abgehängte Regionen und Armutsinseln: Im Süden Frankreichs und Italiens liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 40 Prozent. Und noch immer leben in der Eurozone mehr als 19 Millionen Menschen in Armut, davon alleine 2,2 Millionen Menschen in Griechenland.
Ich bin in den vergangenen Jahren vor allem da hingereist, wo die soziale Lage besonders dramatisch ist. In Palermo, Thessaloniki, Lissabon oder Marseille traf ich junge Leute, die sich mit unbezahlten Praktika und Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Kein funktionierender Sozialstaat – allein die familiäre Unterstützung hat sie vor der sozialen Katastrophe bewahrt. Doch zwischen Wut und Enttäuschung schimmerte auch Hoffnung auf. Diese jungen Leute haben Europa eben noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil! Das macht mir Mut – und es spornt mich an.
In diesen Zeiten der drohenden sozialen Spaltung muss sich die EU noch viel stärker als soziales Korrektiv verstehen. Mit der Lissabon- und der „Europa 2020“-Strategie haben wir uns in den vergangenen beiden Jahrzehnten zwar durchaus ehrgeizige Ziele gesetzt, um europaweit mehr Wachstum und Beschäftigung zu erreichen. Beide Strategien krankten allerdings daran, dass die praktische Umsetzung viel zu vage blieb. Damit Koordinierung wirkt, braucht sie mehr Verbindlichkeit!
Wo wollen wir also hin mit der Eurozone im kommenden Jahrzehnt? Es muss unser Anspruch sein, die massiven sozialen Ungleichgewichte in den 19 Euro-Staaten auszubalancieren und bis zum Jahr 2030 annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse zu erreichen.
Eine zukunftsweisende „Euro 2030“-Strategie könnte darauf abzielen, in der Eurozone eine qualitativ vergleichbare soziale Mindestversorgung zu garantieren – über verbindliche Leitlinien, Zielkorridore und Mindeststandards in der Bildungs- und Beschäftigungspolitik, Altersvorsorge, Gesundheitsversorgung sowie Armutsbekämpfung. Die Einhaltung der Ziele könnte von einem europäischen Sozialminister überwacht werden, der ebenso wie eine europäische Finanzministerin von einem Euro-Parlament aus Abgeordneten des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente demokratisch kontrolliert wird.
Die Eurozone hat als Tempomacher im „Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ schon immer eine besondere Verantwortung für Stabilität und Zusammenhalt der gesamten EU getragen. Was in dieser Debatte aber oft zu kurz kommt: Vertraglich sind alle EU-Staaten – mit der Ausnahme von Dänemark und derzeit noch Großbritannien – dazu verpflichtet, die Gemeinschaftswährung einzuführen, sobald sie die Konvergenzkriterien erfüllen. Derzeit verstoßen jedoch einige Nicht-Euro-Staaten ganz bewusst gegen diese Auflagen, um im Falle einer Krise weiter ihre nationalen Währungen frei auf- und abwerten zu können.
Wollen wir uns damit etwa zufrieden geben? Wir müssen aus dieser Verlust- endlich wieder eine Gewinnerdebatte machen: Indem wir die Eurozone mutig und entschlossen so reformieren, dass es für die verbliebenen sieben Nicht-Euro-Staaten deutlich attraktiver ist, zu den Euro-Tempomachern aufzuschließen als weiter am Schluss des Feldes zu bleiben. Die Euro-Mitgliedschaft muss künftig der Turbo für soziale Stabilität, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und solide Finanzen werden! Das wäre das beste Rezept gegen künftige Krisen.
Den Horizont erweitern – den Freundeskreis pflegen und ausbauen.
Vorschlag: Friedens- und Stabilisierungsprojekt Europa mit Beitrittsperspektive für westlichen Balkan und Osteuropa
Wer eine Sinnkrise überwinden will, dem hilft dabei ein stabiles Umfeld. Auch Europa braucht gute Freundinnen und Freunde, auf die es sich in Krisen ohne Wenn und Aber verlassen kann. Vor der Haustür warten frische Impulse und ungeahnte Gemeinsamkeiten. Introvertiertheit und Abschottung sind da eher kontraproduktiv, gegenüber unseren engsten Nachbarn brauchen wir mehr Neugier und Offenheit.
Gute Nachbarschaft, Stabilität und Frieden in Europa sind alles andere als selbstverständlich. Vor einigen Tagen besuchte ich Maillé, ein kleines Dorf im Westen Frankreichs. Dort begingen deutsche Truppen am 25. August 1944 ein barbarisches Massaker, bei dem 124 Menschen grausam ermordet wurden. Eine Frau, damals noch ein kleines Mädchen, erzählte mir, wie sie nur durch Zufall überlebte. Sie hatte sich an diesem Tag mit ihren Eltern gestritten und war fortgelaufen. Ihre gesamte Familie wurde an diesem Tag ausgelöscht. Der Tag des Massakers war ihr Geburtstag, den sie seitdem nie wieder gefeiert hat. Bis zum heutigen Tag macht sie sich schwere Vorwürfe, dass sie überlebt hat und ihre engsten Angehörigen nicht.
Maillé ist wie Ypern und Verdun, Auschwitz und Stalingrad und Srebrenica einer der vielen Orte des Grauens in Europa. Sie erinnern uns daran, wohin Hass und blinder Nationalismus führen können. Heute werden Konflikte in der EU glücklicherweise nicht mehr gewaltsam auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch ausgetragen. Aus erbitterten Feinden sind Freunde und Partnerinnen geworden, die friedlich und respektvoll miteinander leben und eng zusammenarbeiten. Welch großartiger zivilisatorischer Fortschritt!
Doch leider sind Frieden, Stabilität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eben nicht überall in Europa gelebte Wirklichkeit. Bislang ist es uns nicht gelungen, aus dem Friedensprojekt EU auch wirklich ein gesamteuropäisches Friedens- und Stabilisierungsprojekt werden zu lassen.
Und da schaue ich vor allem mit Sorge auf unsere östliche Nachbarschaft: Gerade in diesem Moment wird auf europäischem Boden – unter maßgeblicher Verantwortung Russlands – ein blutiger Krieg geführt. Trotz zahlreicher diplomatischer Initiativen sterben an der ostukrainischen Front fast täglich Menschen. Und der aktuelle Konflikt im Asowschen Meer macht uns einmal mehr deutlich, wie fragil die Lage in der Ukraine ist. Auch in Georgien, Armenien und Moldau gibt es eingefrorene Konflikte, die jederzeit wieder aufbrechen können.
In den 1990er Jahren haben wir auf dem Westlichen Balkan erlebt, was es bedeutet, wenn es eben keinen europäischen Stabilitätsanker gibt. Damals sind im ehemaligen Jugoslawien im Zuge blutiger Bürgerkriege hunderttausende Menschen getötet, vertrieben oder in die Flucht getrieben worden – weil man es nicht mehr vermocht hat, ein friedliches Miteinander der unterschiedlichen Ethnien, Religionen und Kulturen aufrechtzuerhalten.
Die gesamte Region hat seit dem Gipfel von Thessaloniki 2003 eine konkrete EU-Beitrittsperspektive, die wir immer wieder bekräftigt haben. Denn der Westliche Balkan ist eben nicht der Hinterhof Europas, sondern der Innenhof des europäischen Hauses. Auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft gibt es ohne Zweifel noch viel zu tun: Alle sechs Staaten des Westlichen Balkans haben, wenn auch in unterschiedlichem Maße, mit Korruption und organisiertem Verbrechen, Mängeln bei der Regierungsführung und ungelösten regionalen Konflikten zu kämpfen. Diese Erweiterungsrunde ist vor allem deshalb so mühsam, weil wir die Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit gezogen haben. Deshalb stehen nun gleich am Anfang der Gespräche die schwierigsten Kapitel: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung der Korruption.
Für die Länder der Östlichen Partnerschaft gibt es eine solche konkrete EU-Beitritts-perspektive nicht. Das mag gute Gründe haben. Aber dennoch sollten wir diesen Ländern deutlich mehr anbieten als bisher, mindestens eine „Östliche Partnerschaft plus“. Vor allem in der Ukraine, Georgien und Moldau sehnt sich die deutliche Mehrheit der Bevölkerung nach der EU. Doch bei uns in der EU bleiben Skepsis und Uneinigkeit dagegen weiterhin groß.
Wenn ich heute – fünf Jahre nach den proeuropäischen Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew – mit jungen Ukrainerinnen und Ukrainern spreche, erlebe ich vor allem eines: Ernüchterung, enttäuschte Hoffnungen und Ungeduld. Und um es mal ganz offen zu sagen: Diese jungen Menschen, die sich so sehr nach Europa sehnen, fühlen sich zunehmend von uns in Stich gelassen. Und ich kann ihnen nur sehr schwer erklären, warum wir von der Ukraine zwar stetig Reformen einfordern, aber selbst nicht bereit sind, den Menschen vor Ort ein attraktives Angebot zu machen. Wofür dann überhaupt Reformen? Warum dann noch in der Ukraine bleiben?
Mir geht es vor allem darum, dieser jungen Generation eine hoffnungsvolle Perspektive in ihren Heimatländern aufzuzeigen. Ich möchte diesen jungen Menschen gerne zurufen: „Bleibt in Eurer Heimat – weil Ihr Lust auf Euer Land und auf Europa habt! Denn Ihr gehört zu uns.“ Wie wäre es etwa mit einem Jugend- und Bildungswerk der Östlichen Partnerschaft, das von der EU finanziert und betrieben wird? Mit dem Regional Youth Cooperation Office (RYCO) gibt es ja schon ein innovatives Format auf dem Westbalkan.
2019 feiert die Östliche Partnerschaft ihren zehnten Geburtstag: Ein guter Anlass, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und miteinander auszuloten, wie eine neue europäische Ostpolitik aussehen könnte. Und ich ahne, dass da noch schwierige interne Debatten auf uns zukommen – denn sowohl beim Thema Russland als auch in der Erweiterungsfrage haben wir in der EU bislang nur einen Minimalkompromiss.
Klar ist aber auch: Eine neue europäische Ostpolitik darf sich nicht dem Denken in geostrategischen Einflusssphären beugen. Sie darf vor allem niemals dazu führen, dass souveräne, unabhängige Staaten zwischen ihren traditionellen Bindungen zu Russland und ihrer Europaorientierung zerrieben werden. Niemandem, auch Russland nicht, steht ein Veto-Recht zu. Denn Hinwendung zu Europa bedeutet ja eben nicht zwangsläufig eine Abwendung von Russland. In diesen Fragen brauchen wir mehr Taktgefühl statt Paktgefühl!
Partnerinnen und Partner einbeziehen – einander zuhören und ernst nehmen.
Vorschlag: Europäische Demokratie durch Dialog und Beteiligung stärken
Krisen können ziemlich einsam machen. Dabei entwickeln sich die besten Lösungen in der Regel nicht, wenn man die Probleme mit sich selbst ausmacht, sondern im Austausch mit Freundinnen und Partnern, die auch mal widersprechen und einen neuen Gedankenanstoß geben.
Auch die europäische Demokratie ist ohne offenen Dialog nicht denkbar. Solange ich mich mit Europapolitik beschäftige, sind die Bürgerferne und das Demokratiedefizit der EU ein viel diskutiertes Dauerthema. Trotz mancher Neuerung tut sich die EU immer noch schwer mit der direkten Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch: Mindestens genauso so sehr fremdeln die Bürgerinnen und Bürger mit der Europapolitik. Das schwierige Verhältnis beruht also durchaus auf Gegenseitigkeit.
Wie in jeder Beziehung hilft es, miteinander zu reden, wenn es kriselt. Und in Sachen Europa gibt es eine ganze Menge Gesprächsbedarf! In diesem Jahr haben wir deshalb ein großes europaweites Experiment gewagt: In den vergangenen Monaten waren alle Europäerinnen und Europäer eingeladen, sich an einer breiten Diskussion über die Zukunft Europas zu beteiligen. Die Idee geht zurück auf eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. 27 Mitgliedstaaten haben mitgemacht. Alleine in Deutschland fanden von Mai bis Oktober 2018 mehr als 100 Dialogveranstaltungen mit über 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.
Ziel war es, bis zum Herbst 2018 ein möglichst umfassendes Stimmungsbild über die Erwartungen, Sorgen und Kritik der Europäerinnen und Europäer zu erhalten. Und nicht nur das: Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern das Angebot gemacht, dass die Ergebnisse der Bürgerdialoge mit in die Beratungen beim Europäischen Rat am 13./14. Dezember einfließen. Dass in ganz Europa nicht nur diskutiert wird, sondern echte Ergebnisse gesammelt und direkt an die Staats- und Regierungschefs gerichtet werden, kann eine Chance sein.
Vielen geht dieser Prozess noch nicht weit genug – auch mir nicht! Bei den Bürgerdialogen bin ich in der Regel mit politisch interessierten, akademisch ausgebildeten und tendenziell proeuropäischen Menschen zusammengetroffen. Ein repräsentativer Querschnitt unserer Gesellschaft ist das nicht. Es reicht eben nicht, wenn wir uns nur mit den „usual suspects“ austauschen und uns gegenseitig versichern, wie großartig Europa doch ist. Viel schwieriger ist es, auch denjenigen konkrete Gesprächsangebote zu unterbreiten, die eben nicht zur polyglotten, weltgewandten Bevölkerung gehören. Und diese Frage treibt mich um: Wie können wir die Köpfe und Herzen derjenigen erreichen, die sich längst aus den gesellschaftlichen Diskursen zurückgezogen haben und in ihren europaskeptischen Echokammern verharren?
Deshalb ist mein Vorschlag, auf unseren positiven Erfahrungen mit den Bürgerdialogen aufzubauen und das Format zu regelmäßigen Europa-Foren weiterzuentwickeln.
Um über einen reinen Elitendiskurs hinauszukommen, werden die Foren künftig zumindest zur Hälfte mit repräsentativ ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern besetzt. Insbesondere in den Grenzregionen sollten wir die Veranstaltungen ausbauen. Vor allem braucht der Europa-Dialogprozess mehr Verbindlichkeit. Wer mitdiskutiert, muss wissen, was am Ende mit den Ergebnissen passiert. Deshalb sollten die von den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiteten Ideen künftig in öffentlichen Debatten im Europäischen Parlament, im Ministerrat und in den nationalen Parlamenten diskutiert werden.
Wer die EU bürgerfreundlicher machen will, muss die junge Generation stärker beteiligen. Denn bei keiner Altersgruppe ist die Zustimmung zur EU so hoch wie unter den 15- bis 24-Jährigen. Gleichzeitig bleibt die Wahlbeteiligung bei Europawahlen bei den Jüngeren aber deutlich unter dem Durchschnitt. Jüngere Europäerinnen und Europäer setzen immer weniger auf die konventionellen Formen der politischen Beteiligung, sondern sie werden eher punktuell und themengebunden politisch aktiv. Damit müssen wir klug und umsichtig umgehen – beispielsweise durch eine Senkung des Mindestalters bei der Europäischen Bürgerinitiative von 18 auf 16 Jahre oder die stärkere Nutzung von innovativen Online-Dialogformaten.
Junge Leute sind häufig proeuropäisch, weil sie ganz selbstverständlich in Europa reisen, studieren oder lieben. Ältere bewegen sich dagegen eher auf eingespielten Wegen und werden seltener aufgefordert, etwas ganz Neues zu wagen. Hier setzt ein weiterer Vorschlag von mir an: Warum gründen wir nicht einen europäischen Freiwilligendienst für Seniorinnen und Senioren im besten Alter, eine Art „Europaweit 60plus“? Die ältere Generation bringt so viel Erfahrung und Expertise mit, von der ganz Europa profitieren kann.
Ich stelle mir vor, dass der pensionierte Deutschlehrer aus Siebenbürgen Roma-Kindern in Duisburg Deutsch beibringt oder die 60-jährige Schlossermeisterin aus Berlin in Andalusien bei einer Flüchtlingsinitiative ihre Kenntnisse weitergibt. So wird Europa für alle Generationen erlebbar – jenseits von Urlaubsreisen und Fernsehbildern!
Aber es geht nicht nur darum, die Bürgerinnen und Bürger „europäischer“ zu machen. Auch uns Politikerinnen und Politiker stünde es gut zu Gesicht, unsere Routinen und Arbeitsweisen kritisch infrage zu stellen. Ich zumindest tue das. Denn auch in Brüssel könnten wir die Türen und Fenster sperrangelweit öffnen, um endlich wieder frische Luft und neue Ideen reinzulassen. Wie wäre es damit? Der Ministerrat verlässt das triste Justus-Lipsius-Gebäude und die fensterlosen Hinterzimmer der europäischen Demokratie und tagt öffentlich. Ratssitzungen finden so oft es geht in Universitäten, Betrieben oder sozialen Einrichtungen statt.
Den eigenen Prinzipien folgen – sich selbst treu bleiben und anständig miteinander umgehen.
Vorschlag: Rechtsstaatlichkeit und Gleichstellung in Europa stärken
Kommen wir zu meinem vierten Ratschlag für Europa. Wer in einer Lebenskrise steckt, der ist meist aus der Spur geraten und folgt nicht mehr seinem inneren Kompass. Um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen, hilft es, sich auf seine Werte und Prinzipien zu besinnen. Sie verbinden mit Gleichgesinnten und geben eine Richtschnur für den anständigen Umgang mit anderen.
Auch innerhalb der EU laufen einige Mitgliedsländer Gefahr, sich von ihrem Wertekompass zu verabschieden. Derzeit streiten wir in der EU ausgerechnet darüber am heftigsten, was uns den vergangenen sechs Jahrzehnten stark gemacht hat: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, kulturelle, ethnische und religiöse Vielfalt, Presse- und Meinungsfreiheit, der Schutz von Minderheiten sowie die Gleichstellung von Männern und Frauen – diese gemeinsamen Werte sind der Kern unserer europäischen Identität.
Die EU ist eben mehr als nur ein Binnenmarkt. Sie ist vor allem eine Wertegemeinschaft, eine Rechtsstaatsfamilie, ein einzigartiges Demokratieprojekt! Doch der Bestand unserer Grundwerte ist keine reine Selbstverständlichkeit, sie müssen jeden Tag aufs Neue gepflegt und verteidigt werden.
In einigen Mitgliedstaaten der EU gibt es Entwicklungen und Tendenzen, zu denen man nicht einfach schweigen darf. Ich denke beispielsweise an Polen, Ungarn, in jüngster Zeit auch an Rumänien. Wenn Demokratie offen in Frage gestellt wird, wenn rechtsstaatliche Grundprinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit aufgeweicht, ja ausgehöhlt werden, dann steht das Fundament für unser friedliches und regelbasiertes Zusammenleben in Europa auf dem Spiel.
Und deshalb ist die Frage, ob diese Werte und Prinzipien in einem Land geachtet werden, eben auch keine rein nationale Angelegenheit. Nein, diese Frage geht uns alle an! Und deshalb müssen wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass wir unsere Werte konsequent einhalten und entschlossen reagieren, wenn sie in Bedrängnis geraten.
Endlich haben die EU-Institutionen bei Rechtsstaatsverstößen einzelner Staaten unmissverständlich Position bezogen. Gegen Polen leitete die Kommission im Dezember 2017 ein Verfahren nach Artikel 7 EUV ein, das in letzter Konsequenz zum Entzug des Stimmrechts im Rat führen kann.
Das Europäische Parlament verabschiedete im September einen Bericht, in dem auch ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn gefordert wird. Und erst kürzlich verpflichtete der Europäische Gerichtshof die polnische Regierung dazu, die Zwangspensionierung von Richterinnen und Richter des Obersten Gerichtshof wieder zurückzunehmen. Das war ein Sieg für den Rechtsstaat!
Dennoch werde ich immer wieder gefragt, ob die vorhandenen Mechanismen nicht ein stumpfes Schwert seien. Richtig ist: Im Instrumentenkasten der EU fehlt noch ein praktikabler Mechanismus, der auf der Eskalationsstufe irgendwo zwischen dem juristischen Zahnstocher (also den klassischen Vertragsverletzungsverfahren) und der politischen Bombe (also dem Verfahren nach Artikel 7 EUV) zu verorten ist.
Und es ist offensichtlich: In der Praxis ist es deutlich schwieriger, Demokratiesünden zu ahnden als beispielsweise Haushaltssünden.
Für die EU ist der Umgang mit den Grundwerten zu einem gefährlichen Spaltthema zwischen Ost und West geworden: In der Debatte höre ich immer wieder, die westlichen Länder der EU – einschließlich Deutschland – würden das Thema Rechtsstaatlichkeit als Deckmantel nutzen, um Druck auf andere Staaten auszuüben. Andere wiederum werfen uns vor, wir würden mit zweierlei Maß messen und unsere Werte über die unserer mittel- und osteuropäischen Partner stellen.
Diese Argumente verstehe ich nicht: Unsere Werteunion ernst zu nehmen, ist doch keine Frage von Machtpolitik sondern von Prinzipienfestigkeit! Meine Einschätzung und Kritik wäre dieselbe, wenn wir über Entwicklungen in Frankreich, Schweden oder Deutschland sprechen würden. Ich jedenfalls arbeite dafür, dass unsere gemeinsamen Werte uns künftig wieder zusammenschweißen statt uns auseinanderzutreiben.
Daher werbe ich dafür, dass sich alle EU-Staaten künftig auf freiwilliger Basis einer regelmäßigen Überprüfung der Lage der Rechtsstaatlichkeit unterziehen – als Gleiche unter Gleichen. Ich denke dabei an eine Art Rechtsstaats-TÜV, der dem Universal Periodic Review des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen nachempfunden ist. Das heißt: Nicht nur die üblichen Verdächtigen würden überprüft, sondern reihum müssten sich alle den kritischen Fragen der anderen stellen. Sollten rechtsstaatliche Defizite festgestellt werden, müsste der betreffende Mitgliedstaat im Folgejahr berichten, welche konkreten Gegenmaßnahmen er ergriffen hat.
Aber auch im Rahmen der anstehenden Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen sollten wir das Thema Rechtsstaatlichkeit mitdenken: Ich unterstütze den Vorschlag der EU-Kommission, die Auszahlung von EU-Mitteln künftig an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu koppeln. Aber daneben brauchen wir auch Instrumente, mit denen wir unsere Wertegemeinschaft präventiv stärken können.
Deshalb rege ich an, im EU-Haushalt einen „Fonds für europäische Grundwerte“ einzurichten. Damit könnten Nichtregierungs- und zivilgesellschaftliche Organisationen überall dort unterstützt werden, wo Demokratie und Rechtsstaatlichkeit besonders unter Druck stehen.
Wie wir innerhalb der EU mit unseren Werten umgehen, ist letztlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit: Denn nur wenn wir unsere Werte und Prinzipien nach innen uneingeschränkt vorleben, können wir sie auch nach außen glaubhaft von Drittstaaten einfordern. Zum Beispiel von der Türkei, wo derzeit eklatante Rückschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verzeichnen sind.
Wir sollten jedoch niemals den Fehler machen, ein ganzes Land mit einer Regierung gleichzusetzen: Deutschland ist nicht Merkel – und ebenso wenig ist die Türkei Erdogan. Regierungen kommen und gehen – aber die Bürgerinnen und Bürger bleiben. „It’s the civil society, stupid!“ – auf die Zivilgesellschaft kommt es an, wenn wir die Grundwerte stärken wollen!
Das sind wir nicht nur denjenigen schuldig, die in der Türkei mutig für Freiheit, Menschenrechte, ein offenes und pluralistisches Gesellschaftsmodell eintreten, sondern auch den rund 3 Millionen türkeistämmigen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Sie dürfen wir nicht vor den Kopf stoßen, müssen gleichzeitig aber auch klar machen: Unsere Grundwerte sind für uns nicht verhandelbar!
Ich freue mich, dass wir dieses Thema später in der Diskussion noch weiter mit Deniz Yücel vertiefen können.
Miteinander und voneinander lernen – das gilt beim Thema Werte auch für das Thema Gleichstellung. Vor Ihnen steht ein überzeugter Feminist! Europa und die Politik im Allgemeinen bunter, vielfältiger und ja, auch weiblicher zu machen, ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen.
Einen zugegebenermaßen bescheidenen persönlichen Beitrag versuche ich selbst zu leisten, indem ich mich der Initiative “Jamais sans elles„ (“Niemals ohne Frauen„) angeschlossen habe. Seit einigen Monaten unterstütze ich ausschließlich Veranstaltungen, an der Frauen angemessen beteiligt sind.
Aber solche kleinen Schritte alleine reichen eben nicht. Vorreiter und Vorbild bei der Gleichstellung ist für mich vor allem Schweden. Die sozialdemokratisch geführte Regierung hatte sich 2014 als erstes Land der Welt zu einer “feministischen Außenpolitik„ bekannt, die weltweit die Rechte, Repräsentation und Ressourcen von Frauen stärken will. Vor einigen Wochen hat Außenministerin Margot Wallström sogar ein Handbuch vorgelegt – ein Leitfaden, an dem sich auch andere Länder ein Beispiel nehmen können.
Auch wir in der EU! Denn die Zeit ist reif für eine feministische Europapolitik! Die Gleichheit von Männern und Frauen zählt zu den Grundwerten der EU, die in Artikel 2 EUV und der Grundrechtecharta ausdrücklich genannt werden. Aber ich habe den Eindruck, dass wir beim Gleichstellungsprojekt Europa trotz aller Fortschritte durchaus noch Luft nach oben haben.
Denn Gleichstellung fängt schon bei der Haushaltspolitik an: Geben wir etwa mehr Geld für Projekte im Landwirtschafts- oder Infrastrukturbereich aus, profitieren davon relativ gesehen eher Männer, die in diesem Sektor traditionell stärker vertreten sind. Kürzen wir dagegen öffentliche Mittel im Bereich Nahverkehr, betrifft das tendenziell eher Frauen. Denn leider sind es immer noch mehrheitlich Frauen, die die Kinderbetreuung übernehmen, in Teilzeitjobs arbeiten und somit auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesen sind.
Doch das muss nicht so sein – dank “Gender Budgeting” oder „geschlechtersensibler Haushaltsführung“. Was sich so kompliziert anhört, ist eigentlich ganz einfach: Wir verpflichten uns, bei jeder Ausgabe genau zu prüfen: Wer ist die Zielgruppe, wer profitiert davon und wie geschlechtergerecht ist sie? Haushaltspläne werden systematisch analysiert und angepasst. Auf EU-Ebene gibt es das bislang nur als unverbindliche Empfehlung.
Ich fordere, dass „Gender Budgeting“ künftig beim ganzen EU-Haushalt und der Vergabe von Fördermitteln durchgeführt wird – und zwar verpflichtend. Damit sich auch strukturell etwas ändert!
Es geht aber nicht nur um Rechte und Ressourcen, sondern auch um Repräsentation: Ohne eine angemessene Vertretung von Frauen in den Entscheidungsgremien ist heute kein Staat mehr zu machen – und erst recht keine Europäische Union. Doch im Europäischen Parlament und in der EU-Kommission ist das weibliche Geschlecht nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Für eine Organisation wie die EU, die sich selbst gerne stolz auf die Fahnen schreibt, weltweit führend bei Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit zu sein, ist das enttäuschend.
Dabei können schon drei simple Schritte helfen, um die „gläserne Decke“ einzureißen, an die Frauen auch in der Europapolitik immer wieder stoßen: Erstens verabschieden wir 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland endlich ein Paritätsgesetz, das alle Parteien dazu verpflichtet, ihre Wahllisten fair zwischen den Geschlechtern zu quotieren. Zweitens gehen wir als Bundesregierung mit gutem Beispiel voran und verpflichten uns selbst, im kommenden Jahr als deutsches Kommissionsmitglied eine Frau vorzuschlagen. Und drittens sollten die Abgeordneten des neu gewählten Europäischen Parlaments gegenüber dem künftigen Kommissionspräsidenten und den Staats- und Regierungschefs ganz selbstbewusst den Anspruch formulieren: Wir werden keinem Kommissionskollegium mehr zustimmen, das nicht zur Hälfte aus Frauen besteht!
Sie sehen schon: Es könnte eigentlich ganz einfach sein mit dem Wandel. Daher sage ich: Keine Ausreden mehr, wir haben es selbst in der Hand, Europa aus dieser Krise zu führen.
Jetzt geht es um das, was uns in Budapest und Duisburg, in Maillé und Zagreb und auch hier im Berliner Basecamp verbindet: Wählen gehen, Demokratie stärken. Nicht meckern, sondern machen. Die Europawahl im Mai 2019 wird zum Lackmustest darüber, ob wir den aggressiven Vormarsch von Nationalismus und Populismus zu stoppen vermögen.
Wir haben es selbst in der Hand, Europa aus der Sinnkrise zu führen. So eine Midlife-Crisis kann durchaus auch etwas Gutes haben. Man verlässt die routinierten Pfade, wagt etwas Neues, bleibt sich selber treu und fühlt den Geist des Aufbruchs. Und genau das alles schlummert auch in Europa. Wecken wir es auf!