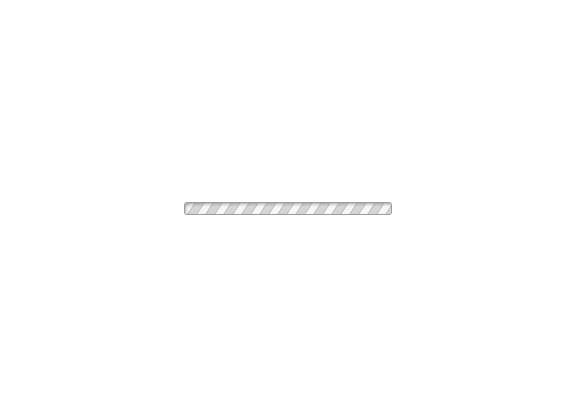Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei der Verleihung des Europapreises für politische Kultur in Ascona
Lieber Frank Mayer,
sehr geehrter Herr Bundesrat Alain Berset,
meine Damen und Herren,
ich freue mich sehr, zurück zu sein, beim „diner republicain“. Letztes Mal war ich hier im Jahr 2007 als Laudator für Boris Tadic. Es ist mir aber ganz und gar nicht unangenehm, heute in anderer Funktion wieder dabei zu sein. Mit anderen Worten: es ist mir eine große Freude und Ehre, von Ihnen den Europapreis für politische Kultur entgegenzunehmen.
Und ich danke Ihnen, verehrter Herr Bundesrat, lieber Alain Berset, herzlich für die netten Worte.
Ja, in der Tat: Es sind stürmische Zeiten, in denen wir uns hier im schönen Ascona treffen. Und damit meine ich nicht die sanften Wellen auf dem Lago Maggiore. Leider nicht. Nein, ich fürchte, wer sich wie Sie, lieber Herr Mayer, den Außenminister ins Haus – oder besser: ins Zelt holt, den erwartet keine Schönwetter-Rede. Und: der muss sich die gute Laune leider selber mitbringen.
Die Krisen der Welt halten uns in Atem. Syrien, Ukraine, Irak, Libyen, Jemen – wir erleben Krisen und Konflikte in unserer Nachbarschaft, wie ich sie in dieser Dichte und Komplexität in meiner politischen Laufbahn noch nie erlebt habe. Vor drei Jahren kam ich zum zweiten Mal als Außenminister ins Amt. Aber wer hätte vor 3 Jahren geahnt, vor welchen Realitäten wir heute stehen? Dass ein großes Land, Russland, mit der Annexion der Krim die Frage von Krieg und Frieden wieder nach Europa bringen würde? Eine Frage, die wir längst überwunden glaubten! Wer hätte zweitens geglaubt, dass eine islamistische Organisation sich ein ganzes Territorium unter den Nagel reißen würde? Und dass Tausende aus der jungen Generation aus unseren Ländern - fasziniert von Gewalt und „Kampf bis aufs Blut“ in den Djihad ziehen- vor allem nach Syrien?
Die Krisen, mit denen wir zu tun haben, sind keine fernen, abstrakten Konflikte. Nicht nur deshalb, weil jeder durch die neuen Medien einen unendlichen Zugang zu den Bildern dieser Konflikte hat - zu jeder Zeit. Nein, die neue Unordnung der Welt ist greifbar für jeden zu uns gekommen mit den Abertausenden, die bei uns Schutz suchen vor Krieg und Gewalt. Sie hat nicht nur Einzug gehalten in unsere Nachrichten, sondern in unsere Gemeinden, Schulen und Kindergärten.
Und mit den furchtbaren Anschlägen von Nizza, Brüssel, Paris haben auch die dunkelsten Seiten dieser Umbrüche Einzug gehalten auf unsere Innenstädte und Marktplätze und damit ein Gefühl der Unsicherheit, des Kontrollverlustes und der Ohnmacht.
***
Was halten wir Europäer dem entgegen?
Vor fast genau 70 Jahren am 19. September 1946 reiste Winston Churchill nach Zürich. Er reiste in den – wenn man so will – letzten unverwüsteten kleinen Flecken auf dem europäischen Kontinent, in die Schweiz, um die Europäer aufzurufen, sich hinter einer geradezu unerhörten Vision zu versammeln.
„Heute starren ungeheure Massen zitternder menschlicher Wesen gequält, hungrig, abgehärmt und verzweifelt auf die Ruinen ihrer Städte und Behausungen“, rief Churchill damals aus und weiter: „wäre jemals ein vereintes Europa imstande, sich das gemeinsame Erbe zu teilen, dann genössen seine drei- oder vierhundert Millionen Einwohner Glück, Wohlstand und Ehre in unbegrenztem Ausmaße.“
Meine Damen und Herren - bei allen Problemen, die wir in Europa haben - heute sind es 500 Millionen, und viele Staaten haben sich von Armenhäusern an der europäischen Peripherie zu wirtschaftlich erfolgreichen Mitgliedstaaten der EU entwickelt. Das ist meines Erachtens die erste Antwort, die wir geben müssen: Wir müssen Europa nicht schönreden und Defizite nicht verschweigen, aber wir sollten selbstbewusst auf das Erreichte schauen und dürfen uns nicht unnötig klein vor unserer eigenen Geschichte machen!
Deshalb: In den ersten Tagen nach dem britischen Referendum haben wir uns unter den europäischen Außenministern in vielen unterschiedlichen Formaten getroffen. Hierunter war auch ein Treffen, zu dem ich die EU-Gründerstaaten ganz bewusst eingeladen hatte. Wir lassen uns dieses Europa nicht kaputtmachen! Dies war das Signal, das von diesem Treffen ausging und ich bin überzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, in Zeiten von Verunsicherung und Zweifeln Haltung zu zeigen.
Und noch ein Zweites mahnt uns der Blick auf Churchills historische Rede: Mit Europa spielt man nicht. Das habe ich unseren britischen Freunden gesagt, die aus einer innerparteilichen Auseinandersetzung, einem Konkurrenzkampf zweier Studienkameraden, ihr Land vor eine historische Schicksalsfrage geführt haben - mit heute unabsehbaren Folgen. Und übrigens einhergehend mit einer beispiellosen Flucht aus der Verantwortung hinterher.
Das sage ich aber auch unseren Freunden in Polen und Ungarn. Wer den Rückbau des europäischen Einigungswerkes damit betreibt, dass er seinen Bürgern die Schimäre der nationalen Souveränität in der heutigen Welt vormacht, auch der spielt auf gefährliche Weise mit Europa. Und besonders zweifelhaft wird diese Politik, wenn gleichzeitig unter Verweis einer ständigen Bedrohung von außen, Solidarität, sogar militärischer Schutz von anderen eingefordert wird.
***
Aber auch wir, die sich als „Pro-Europäer“ verstehen, müssen ihre Lehren ziehen aus der Vertrauenskrise Europas. Wir haben vielleicht einmal zu oft und zu verbissen theoretische Debatten über institutionelle Fragen geführt. Die Bürger Europas wollen nicht wissen, ob Kommission, Rat oder Parlament zum Handeln berechtigt sind. Sie wollen Taten sehen. Sie wollen, dass Europa Schutz gewährt vor den Risiken der Globalisierung und sie wollen, dass Europa sich nicht in kleinteiliger Regulierung verliert, sondern sich den großen Fragen des 21. Jahrhunderts widmet. Das stellt den Gründungsgrund Europas, das Friedensnarrativ nicht in Frage, aber es trägt nicht mehr allein für junge Generationen, für die der Frieden selbstverständlich geworden ist und das Gegenteil nicht mehr vorstellbar. Mehr noch: geradezu kontrafaktisch erwarten die Menschen in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt mit immer komplexeren Konflikten umso dringlicher einfache Antworten. Für viele scheint der Rückzug ins Nationale nicht nur attraktiv, er scheint auch die Garantie für die Wiedergewinnung von Kontrolle und Gestaltungskraft.
Wir müssen nicht nur sagen, dass kein Nationalstaat allein, auch nicht der größte Europas, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – von Umwelt und Klima, über Energie, Migration und Sicherheit – lösen kann. Es nicht nur sagen, sondern es tun! Zeigen, dass es europäisch besser geht als national! Antworten geben, wo Menschen darauf warten, aber Europa nicht geliefert hat wie bei gemeinsamen europäischen Antworten auf die Flüchtlingsfrage.
Hierbei werden in Zukunft Gruppen von Mitgliedstaaten vorangehen müssen, die themenbezogen das Heft des Handelns gemeinsam mit den Institutionen in die Hand nehmen. Und wir werden akzeptieren müssen, dass nicht immer alle sofort mitmachen. Dies muss möglich sein, ohne dass wir diejenigen als schlechte Europäer beschimpfen, die langsamer vorangehen wollen. Dies ist das flexible Europa, das ich mir vorstelle und das unter Berücksichtigung unterschiedlicher Erwartungen an Europa in unseren Ländern, gemeinsame Lösungen ausprobiert, anpackt und sich nicht im Zuständigkeitsverhau verheddert.
***
Nicht weniger dringlich ist die Re-fokussierung in der europäischen Außen – und Sicherheitspolitik. Fast nirgendwo ist die Erwartung an Gemeinsamkeit der Europäer größer als hier. „Europa soll mit einer Stimme sprechen“ – Das ist ein Stehsatz aller europäischen Leitartikler.
Vieles mag sogar besser geworden sein als zu Zeiten, in denen Außenpolitik als die eigentliche Domäne mitgliedstaatlicher Souveränität gepflegt und verteidigt wurde. Aber immer sind wir noch besser in Verurteilung und Kommentierung von internationalen Konflikten als in tatkräftiger Bearbeitung und aktiver Lösungssuche.
Dabei haben wir gezeigt, dass unsere gemeinsame europäische Außenpolitik einen Unterschied machen kann: Im letzten Sommer haben wir mit dem Iran ein Abkommen zur friedlichen Beilegung des Atomkonfliktes geschlossen. Dies nach zehn Jahren teils zäher Verhandlungen, mit Rückschlägen und mit den üblichen Kommentierungen von außen über die Fruchtlosigkeit von Diplomatie. Es war John Kerry, der in den frühen Morgenstunden nach Unterzeichnung der Vereinbarung aussprach, was wir alle wussten: Diese Vereinbarung hat nicht nur einen schwelenden Konflikt deeskaliert, es hat einen Krieg verhindert. Ohne die gemeinsame Verhandlungsbeharrlichkeit der Europäer wäre das Atomabkommen mit dem Iran nicht zustande gekommen.
Leider erleben wir bei anderen Themen zu häufig einen Wettbewerb um die schrillsten Töne, die schärfste öffentliche Verurteilung. Was wir erleben in diesen Fällen ist allzu oft ein Missbrauch der Außenpolitik für innenpolitische Zwecke, einhergehend mit einer Einteilung der Welt in Freund und Feind, in Gut und Böse, in schwarz und weiß. Dabei kommt die Realität in vielen Grauschattierungen daher und Aufgabe der Außenpolitik ist es auch, ein gemeinsames Verständnis von der Welt zu gewinnen.
Nicht ein linker Spinner, es war Henry Kissinger, der darauf hingewiesen hat, dass es in den internationalen Beziehungen häufig nicht nur eine Wahrheit gibt. Dass es vielmehr gerade in Konfliktsituationen unterschiedliche Wahrnehmungen derselben Realität gibt. Das erleben wir in diesen Tagen ganz aktuell im Konflikt mit der Türkei: während wir – und zu Recht – die Massenverhaftungen und Entlassungen als Reaktion auf den Putschversuch kritisieren, sieht die türkische Führung darin die europäische Respektlosigkeit im Angesicht der Toten und Verletzten, die die Putschisten zu verantworten haben. Ganz zu schweigen von dem Vorwurf an die Europäer, die Gefährlichkeit der putschistischen Bewegung völlig zu unterschätzen. Es geht überhaupt nicht darum, die Position des anderen zu akzeptieren oder die eigene Position zu relativieren. Aber es darf als Erfahrungssatz der Diplomatie gelten, dass es unklug und gefährlich ist, das eigene außenpolitische Handeln zu bestimmen, ohne die Beweggründe und Wahrnehmung des Gegenübers zu kennen.
Noch mehr als beim aktuellen Konflikt mit der Türkei gilt das beim Thema Russland. Mich ärgert es immer noch maßlos, wenn in der öffentlichen Debatte jede differenzierende Position zu Russland sofort und ohne jedes Nachdenken mit dem medialen Totschlag „Putin-Versteher“ versehen wird. Wo kommen wir hin, wenn das Wort „verstehen“ in der Außenpolitik zum Schimpfwort wird? Politische Kultur in der Außenpolitik heißt auch, bereit zu sein, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen.
„Nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer“ hat Willy Brandt gesagt. Und gemeint hat er in seiner Rede von 1992 Frieden und Demokratie! Nichts anderes gilt für Europa. Frieden, Freiheit und Demokratie wird nicht bleiben, wenn wir nicht Tag für Tag dafür arbeiten
Europa steht vor großen Weichenstellungen. Wenig ist gewiss. Die nächsten 12 Monate sind entscheidend und werden nicht einfach. Umso mehr danke ich noch einmal für die große Ehre, gerade in diesen Zeiten einen so schönen und bedeutenden Preis entgegenzunehmen.