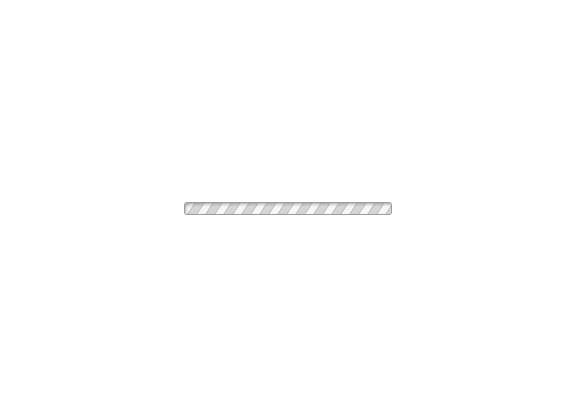Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Türkei ist für Europa Schlüsselland“
Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Erschienen in der Welt am Sonntag am 01.05.2016
Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Erschienen in der Welt am Sonntag am 01.05.2016
***
Herr Minister, ist auf das Wort der Bundeskanzlerin immer Verlass?
Die Zeiten sind nicht einfach. Da muss man sich innerhalb einer Koalition aufeinander verlassen können. Warum fragen Sie?
Wir haben da so unsere Zweifel. Die Bundesregierung will den Beleidigungs-Paragrafen 103 des Strafgesetzbuches abschaffen. Die Unionsfraktion stellt das jetzt infrage.
Es gab Uneinigkeit, wie wir mit dem Drängen des türkischen Staatspräsidenten auf Strafverfolgung wegen Beleidigung umgehen, und am Ende eine streitige Entscheidung. Wir Sozialdemokraten halten Paragraph 103 für überflüssig und wollen ihn jetzt abschaffen. Die Union wird sich zu unserer Initiative verhalten müssen.
Frau Merkel kündigte auch die Abschaffung an. Warum wollen das nun ausgerechnet ihre eigenen Leute verhindern?
Da müssen Sie diejenigen fragen, die entgegen Merkels Ankündigung die Abschaffung jetzt blockieren wollen. Unsere Position verändert das nicht.
Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan dürfte die Entwicklung gefallen. Er verklagt ja nicht nur den Satiriker Jan Böhmermann. Ankara will Fotos in einer Ausstellung in Genf verbieten, protestiert gegen ein Musikprojekt in Dresden, lässt eine niederländische Journalistin in der Türkei festnehmen. Erdogan wütet und poltert. Kann man mit so einem Mann politische Geschäfte machen?
Das ist der Unterschied zwischen Journalismus und Politik. Sie dürfen sich aussuchen, mit welcher Frage Sie sich beschäftigen. Wir müssen zu einem Vorgang mehrere Fragen gleichzeitig beantworten.
Und?
Die Beziehungen zwischen Staaten drehen sich selten nur um einen Aspekt. Unser Verhältnis zur Türkei ist vielschichtig. Die sich verschlechternde Lage von Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei gehört dazu und die sprechen wir an; die Politik gegenüber den Kurden in gleicher Weise. Aber darin erschöpfen sich unsere Beziehungen zur Türkei doch nicht. Jeder weiß doch auch: Die Türkei bleibt für Europa das Schlüsselland für Migration aus den Krisen im Nahen Osten. Es ist Aufgabe der Politik, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber der Vorwurf, wegen des EU-Türkei-Deals schwiegen wir oder kuschten gar gegenüber Ankara, ist schlicht falsch.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
Nein, das ist Politik, nicht Diplomatie. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir es mit einem, zwei oder mehr Problemen auf einmal zu tun haben. Im Verhältnis zur Türkei sind es nunmal mehrere gleichzeitig!
Die Türkei betreibt eine Außenpolitik der Nadelstiche. Implizit lässt sie ihre Macht spüren, notfalls den Flüchtlingsdeal mit der EU platzen zu lassen. Deutschland ist erpressbar geworden.
Erst wurde prophezeit, die Verhandlungen führten ohnehin zu nichts. Nun gibt es ein Abkommen, das tatsächlich erste belegbare Ergebnisse zeitigt: In den drei Wochen vor Inkrafttreten kamen noch knapp 27.000 Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland, in den drei Wochen danach waren es weniger als 6.000. Der Rückgang ist in Wahrheit stärker als die meisten erwartet haben.
Das reden Sie nun arg schön. Der Rückgang resultiert auch aus der Schließung der Balkan-Route. Und die Bundesregierung kritisiert Österreich und Mazedonien, von deren nationalen Grenzmaßnahmen sie profitiert. Ein bisschen bigott, nicht wahr?
Sie wollen die Zusammenhänge nicht sehen: Die Grenzschließung hat zu Idomeni und 50.000 Flüchtlingen in Griechenland geführt. Erst das Abkommen mit der Türkei hat die Grundlage geschaffen, dass jetzt mehr Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen und versorgt werden, kaum noch Flüchtlinge über die Ägäis auf griechische Inseln zu gelangen versuchen und die Westbalkanroute – mindestens zur Zeit – ihre Bedeutung verloren hat.
Da es keinen Plan B gibt, muss der Deal mit Ankara unbedingt halten. Ist es da nicht illusionär, wenn die CSU in dieser Lage die geplante Visafreiheit für die Türken infrage stellt?
Einmal getroffene Vereinbarungen muss man einhalten. Das gilt zwischen Staaten genauso wie zwischen Privaten. Die EU ist deshalb gut beraten, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, natürlich auch die Türkei. Dazu zählt die zugesagte Visa-Liberalisierung, sobald Ankara die nötigen Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Die zugrundeliegenden Beschlüsse des Europäischen Rats haben nicht nur alle EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch die gesamte Bundesregierung mitgetragen und die CSU ist immer noch ein Teil davon.
Bei der CSU schwingt die alte Haltung mit, mit den Türken am liebsten nichts zu tun haben zu wollen, schon gar nicht in der EU. Ist diese jahrelange Zurückweisung ein Grund für Erdogans aggressives Auftreten?
Türkische Verantwortliche haben immer wieder beklagt, dass sie sich trotz Reformen von der EU nicht angenommen fühlten. In den letzten Jahren aber haben wir in der Türkei auch Rückschritte bei Reformen erlebt. Die vom damaligen Ministerpräsidenten Erdogan mutig auf den Weg gebrachte innerstaatliche Aussöhnung mit den Kurden hat einer Politik der Konfrontation Platz gemacht. Die Lage der Pressefreiheit ist für uns Anlass zur ernster Besorgnis. Die Gründe für Stillstand in den Beitrittsgesprächen lagen zuletzt nicht nur auf Seiten der EU.
Hat das lange Hinauszögern des EU-Beitritts die Türkei verändert? Nun rütteln türkische Spitzenpolitiker gar an der säkularen Verfassung...
... Einspruch! Das war ein Votum des türkischen Parlamentspräsidenten. Er ist aber von Präsident Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu schnell zurückgepfiffen worden.
Davutoglu will das „autoritäre Verständnis von Säkularismus“ auflösen. Kann ein Gottesstaat Mitglied der Nato sein?
Auch wenn die Bedeutung des Islam in der türkischen Gesellschaft zugenommen hat: Ministerpräsident Davutoglu hat erklärt, an der säkularen Verfassung festzuhalten. Es gibt für mich keinen Anlass, über die Zukunft der Türkei als Gottesstaat zu spekulieren.
Die Türkei ist ein wichtiger militärischer Spieler in der Region mit einer eigenen Agenda. Wie nahe waren wir eigentlich an einem Krieg, als die Türkei im Winter einen russischen Luftwaffen-Jet abgeschossen hat?
Der Syrien-Konflikt war von Anfang an kein innersyrischer Konflikt, sondern von vielen Interessen naher und fernerer Nachbarn geprägt. Manche Regionalmächte hatten und haben immer noch Einfluss auf die in Syrien kämpfenden Gruppierungen. Moskaus militärischer Einsatz hat nicht nur die Lage am Boden verändert, er hat auch bestehende russisch-türkische Interessengegensätze verschärft. Das spitzte sich mit dem Abschuss des russischen Flugzeugs dramatisch zu. Für einige Stunden bestand wohl das Risiko, dass Russland militärisch reagiert. Dazu kam es zum Glück nicht, aber seither sind die Beziehungen zwischen Ankara und Moskau extrem angespannt.
Hat nach dem Abschuss jemand hinter den Kulissen geschlichtet?
Die Fronten sind bis heute unverändert verhärtet. In der kritischen Situation nach dem Abschuss wäre auch jeder Schlichtungsversuch zu spät gekommen. Und wir können froh sein, dass es zu keiner weiteren militärischen Konfrontation gekommen ist.
Angesichts seines Engagements in Syrien galt Wladimir Putin zwischenzeitlich als neuer Weltpolizist. Wissen Sie, warum etwa der Großauftritt in Syrien so schnell und überraschend endete?
Wir haben anfangs womöglich die russischen Interessen zu eindimensional betrachtet. Es ging nie nur um die Sicherung russischer Militärbasen am Mittelmeer oder darum, Assad zu stabilisieren. Russland will mit seinem Engagement in Syrien sicherstellen, dass die Neuordnung des Mittleren Ostens nicht gegen seine Interessen stattfinden kann. Moskau will von den USA auf Augenhöhe behandelt werden. Das am stärksten unterschätzte Interesse besteht aus meiner Sicht in der Sorge, dass die Radikalisierungstendenzen in den muslimischen Gesellschaften den Südrand Russlands erreichen. Ganz sicher hat Russland aber kein Interesse, sich über Jahrzehnte in Syrien dauerhaft militärisch zu engagieren. Auch dieses Signal sollte offenbar mit dem Teilrückzug der Luftwaffe gesetzt werden. Insofern war es sicher auch ein Signal an Assad und das Regime.
Die politischen Bemühungen zur Lösung des Syrien-Konflikts kommen nur noch langsam voran.
Von einer Lösung des Syrien-Konfliktes sind wir weit entfernt. Manches ist erreicht, aber selbst das Erreichte ist fragil. Nach fünf Jahren Bürgerkrieg und 300.000 Toten bleibt es wichtig, alle Akteure an den Verhandlungstisch zu kriegen und dort zu halten. Das ist 2015 in Wien gelungen, in diesem Februar gab es in München eine Einigung über einen Waffenstillstand und Zugang für humanitäre Hilfe. Die neuerlichen Kämpfe rund um Aleppo und Damaskus erfüllen uns mit großer Sorge. Angriffe auf Krankenhäuser sind abscheulich und unentschuldbar.
Die syrische Opposition hat sich deshalb von den Genfer Gesprächen verabschiedet.
Ich habe in dieser Woche bei dem syrischen Oppositionsführer Riyad Farid Hidschab dafür geworben, nach Genf zurückzukehren. Hidschab und der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura kommen am Mittwoch nach Berlin, um gemeinsam mit uns Ideen für eine Fortsetzung der Genfer Friedensgespräche zu entwickeln.
Spielt die Zeit einmal mehr für Machthaber Assad?
Mit Assad ist die Zukunft Syriens nicht zu gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Opposition an einer Zukunft Syriens mitwirken würde, in der Assad die Geschicke des Landes in seiner Hand behielte. Aber das geht angesichts der tatsächlichen Lage nur Schritt und Schritt. In den Genfer Verhandlungen zwischen syrischer Regierung und Opposition geht es jetzt noch nicht darum, Baschar-al Assad sofort und unmittelbar als Präsident abzulösen, sondern eine effektive Übergangsregierung - mit Vertretern der Opposition und des Regimes - mit exekutiven Aufgaben zu bilden.
Sehen Sie für Libyen mit seiner Einheitsregierung unter UN-Regie mehr Hoffnung als für Syrien?
Am vorletzten Wochenende war ich in Tripolis, die Sicherheitslage ist immer noch höchst prekär. Gerade deshalb sollten wir Respekt zeigen für den Mut der neuen Regierung der Nationalen Einheit, die ihren Weg aus dem Exil in Tunis in die Hauptstadt Tripolis gegangen ist. Das ist noch nicht der Durchbruch. Aber für diesen einen Schritt riskierten die Beteiligten Leib und Leben. Die Akzeptanz der Einheitsregierung steigt, Zentralbank, Ölagentur und Flughafen-Autorität kooperieren, Ministerien werden eingegliedert. Dennoch: die Spannungen zwischen Osten und Westen des Landes bleiben groß. Die Regierung hängt noch an Sicherheits-Arrangements mit verschiedenen Milizen. Was sie braucht sind eigene, loyale Sicherheitskräfte. Wir wollen uns mit Italien und anderen Partnern an der Ausbildung beteiligen. Und: Es dürfen nicht weiter Waffen ins Land gelangen.
Aber mit dem Islamischen Staat (IS) wird die Einheitsregierung wohl kaum fertig.
IS ist kein Schicksal, dem man sich zu ergeben hat. Innerhalb eines Jahres hat IS im Irak 30 Prozent seines Territoriums verloren. Auch in Syrien ist IS schwer unter Druck. In Libyen braucht es eine Verständigung zwischen Ost und West, zwischen Tobruk und Tripolis. Dann lässt sich IS auch erfolgreich bekämpfen.
War es naiv zu glauben, dass man Libyen befrieden kann? Sie haben 2011 die Enthaltung Deutschlands im UN-Sicherheitsrat mitgetragen.
Ich war nach den Erfahrungen im Irak sehr skeptisch, ob man mit derselben Methode das Problem lösen kann. Präsident Obama sieht es inzwischen offenbar auch so: Nach den Luftangriffen waren der zweite und dritte Schritt, die politische Stabilisierung und der Wiederaufbau, nicht vorbereitet. Jetzt braucht es politisches Engagement und langen Atem, die Erosion von Staatlichkeit in Libyen zu reparieren. Ich habe den Eindruck, dass der Groschen jetzt aber bei allen wichtigen Akteuren gefallen ist. Der Weg Libyens zu einem funktionierenden Gemeinwesen wird uns noch viel Zeit abverlangen, aber er kann gelingen.
Mancher sieht die Stabilität unter Gaddafi als das kleinere Übel als das Chaos heute.
Saddam Hussein und Gaddafi sind angesichts der schrecklichen Gräueltaten, die sie auf dem Gewissen haben, alles andere als ein kleineres Übel. Aber ein militärischer Eingriff von außen wendet die Dinge nicht von selbst zum Besseren, wenn der weitere Weg nicht vorbereitet ist.
Wie bewerten Sie das Vorhaben in der EU, den Zustrom von Migranten mit Auffanglagern in Libyen zu stoppen? Für wann ist eine Verständigung mit den libyschen realistisch?
Natürlich haben wir ein Interesse daran, mit den nordafrikanischen Staaten bei der Kontrolle von Flüchtlingsströmen zusammenzuarbeiten. Das tun wir mit Tunesien, Marokko und Algerien. In Libyen erweitert die Regierung der Nationalen Einheit erst langsam Schritt für Schritt ihren politischen Handlungsspielraum. Das geht langsam voran. Aber bis zu einer flächendeckenden effektiven Regierungsgewalt ist es noch ein weiter Weg. Wir dürfen deshalb die neue Regierung nicht überfordern und jetzt schon mit Aufgaben überfrachten, die sie de facto noch nicht erfüllen kann. Wir sollten alles tun, um der neuen Regierung politisch den Rücken zu stärken und konkrete Hilfsangebote zu machen. Schätzen, aber nicht überschätzen, ist mein Rat für die Beurteilung der neuen Regierung in Libyen.
Darum schont man wohl auch Ägyptens Machthaber al Sisi. Wirtschaftsminister Gabriel rühmte ihn kürzlich als „beeindruckenden Präsidenten“. Kommt Realpolitik immer vor der Moral?
Das ist doch Unsinn, und gewiss nicht Leitmotiv deutscher Außenpolitik. Ohne den richtigen Kompass aus Werten und Zielen lässt sich keine vernünftige Außenpolitik machen, auch keine realpolitische. Sigmar Gabriel weiß um die Komplexität der politischen Lage in Ägypten, um die gravierenden Defizite bei den Menschenrechten ebenso wie um die riesigen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, vor den Präsident Sisi steht. Niemand will und kann wollen, dass das große Ägypten mit seinen 88 Millionen Bürgern kollabiert und die Unsicherheit in der Region noch weiter zunimmt.
Der Umgang mit den Saudis, die Kritiker mit Stockschlägen foltern, folgt demselben Muster. Wie glaubwürdig sind die Reformen, die der stellvertretende Kronprinz ankündigt?
Ich bin mit Mohamed bin Salman, dem stellvertretenden Kronprinz, zuletzt zweimal für längere Gespräche in Riad zusammengetroffen. Bei meinem letzten Besuch in Saudi-Arabien haben wir lange darüber gesprochen, wie die militärischen Auseinandersetzungen im Jemen beendet werden können. Ich freue mich, dass die Friedensverhandlungen in Kuwait jetzt begonnen haben, und hoffe, dass wir den Konflikt in Jemen in absehbarer Zeit beilegen können. Der Reformplan von Mohamed bin Salman ist ein wirklich anspruchsvolles Programm. Ich finde das mutig, es ist Ausdruck eines wirtschaftspolitischen Realismus, der nach einer Alternative zum Öl sucht. Mit der Teilprivatisierung des staatlichen Ölkonzerns Aramco schränkt das Königshaus letztlich auch seinen eigenen Einfluss auf die Wirtschaft ein. Die Einschränkungen für die Religionspolizei zeigen, dass auch gesellschaftspolitische Veränderungen nicht mehr tabu sind.
Was bedeutet das für die Beziehungen Deutschlands zu Saudi-Arabien?
Natürlich haben wir nach wie vor stark unterschiedliche Vorstellungen über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft und die Menschenrechte, lehnen die Todesstrafe vehement ab und bringen die Dinge in einer Weise zur Sprache, von der wir glauben, dass das in konkreten Fällen helfen kann. Und gleichzeitig haben wir ein Interesse daran, dass die Reformen gelingen und wir die Beziehungen zu Saudi-Arabien weiter entwickeln und nicht abreißen lassen.
Gilt das auch für Rüstungsexporte?
Da hat sich doch viel verändert. Lieferungen von Waffen, die zu innerstaatlichen Auseinandersetzungen beitragen oder im Jemen-Konflikt eingesetzt werden können, sind doch völlig heruntergefahren. Dagegen gibt es legitime saudische Interessen beim Grenz- und Küstenschutz, wo ich keinen Anlass sehe, die Sicherheitskooperation einzustellen. Das gilt für elektronische Grenzüberwachungssysteme in gleicher Weise wie für die leichten Patrouillenboote, die Saudi-Arabien aus Deutschland bezieht.
Die Freiheit Deutschlands wird ja nicht nur im Nahen Osten oder am Hindukusch verteidigt, sondern neuerdings auch in Mali. Sie reisen an diesem Sonntag dorthin. Erst jüngst hat der Bundestag die deutsche Beteiligung am Uno-Einsatz dort erweitert. Was kann und soll in Mali mit Aufbau Armee und Staat eigentlich besser laufen als in Afghanistan?
Die Subsahara-Region geht uns in Europa an, nicht nur aus humanitären Gründen und nicht nur, weil die ganze Region durch islamistischen Terrorismus bedroht ist. Das ist sehr wichtig. Mali und Niger müssen aber auch stabilisiert werden, um die Flüchtlingsströme aus Afrika besser beherrschen zu können. Die allermeisten der Subsahara-Flüchtlinge kommen über Mali und Niger bis ans Mittelmeer. Beide Staaten ringen um Stabilität und brauchen unsere Hilfe. Mein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault und ich werden deshalb auch im Auftrag der Europäischen Union Migrationsfragen zur Sprache bringen. In Mali hat Frankreich Anfang 2013 mutig und entschlossen verhindert, dass die Hauptstadt Bamako von islamistischen Milizen überrannt wurde. Wir wollen nun sehen, wie der innerstaatliche Aussöhnungsprozess vorangeht und unsere gemeinsame Unterstützung wirkt.
Bis das feststeht, droht die Mittelmeer-Route im Sommer wieder frequentiert zu werden. Wie viele Migranten bereiten sich nach Ihren Kenntnissen aus Nordafrika auf die Überfahrt Richtung Europa vor?
Die Zahlen von Migranten aus Nordafrika sind nicht angestiegen, sie sinken sogar leicht. Es haben sich bisher noch keine Alternativen zur Balkan-Route entwickelt, weder über Italien noch über Albanien. Alles andere ist Spekulation. Aber es ist auch zu früh für Entwarnung. Wir müssen deshalb jetzt die Atempause gut nutzen für gemeinsame europäische Lösungen. Dazu verhandeln wir unter anderem mit Tunesien, Marokko und Algerien, die ja außerdem sichere Herkunftsstaaten werden sollen.
Österreich hat in dieser Woche ein sehr hartes Asylrecht verabschiedet und will den Brenner schließen. Ist das international und mit Schengen kompatibel?
Ich denke, beim Brenner muss man schon unterscheiden zwischen innenpolitischer Rhetorik in einem aufgeheizten Wahlkampf und realer Politik. Die Folgen einer Schließung des Brenners wären auch für Österreich dramatisch.
Kaum jemand redet mehr vom Ukraine-Konflikt, wo sich wenig bewegt. Nehmen Sie einen neuen Anlauf, wo Kiew nun wieder eine Regierung hat?
Die zahlreichen Verhandlungen der letzten Monate, in der Kontaktgruppe, in der OSZE und anderswo, über die offenen Fragen bei der Umsetzung von Minsk haben uns in der Sache leider nicht wirklich vorangebracht. Wir haben Zeit verloren. Die Waffenruhe ist wieder brüchiger geworden, die Zahlen der Waffenstillstandsverletzungen und der Opfer schnellen nach oben. Ich halte es für notwendig, dass wir jetzt einen neuen Anlauf unternehmen, die Blockaden zwischen Kiew und Moskau zu überwinden. Ich habe deshalb zu einem Außenminister-Treffen im Normandie-Format am 11. Mai nach Berlin eingeladen. Es geht um die Vorbereitung von Lokalwahlen, dafür liegen jetzt konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Außerdem gibt es interessante Vorschläge der OSZE für eine Re-Stabilisierung des Waffenstillstandes.
Zur Innenpolitik: In einem seiner letzten Interviews sagte Hans-Dietrich Genscher: „Herr Steinmeier wäre gewiss ein guter Bundespräsident.“ Hat er damit Recht gehabt?
Schade, bisher hatten Sie ganz spannende Fragen…