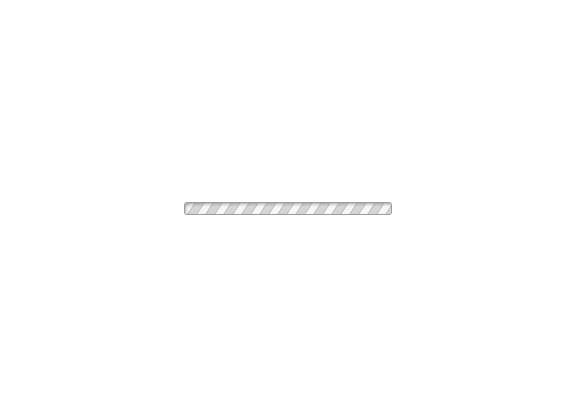Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Nicht zur Tagesordnung übergehen
Außenminister Steinmeier im Gespräch mit der ZEIT über die Krise in der Ukraine, Russlands Rolle und den Sinn von Sanktionen. Erschienen am 16.04.2014.
Herr Minister, Europa erlebt die gefährlichste Krise seit dem Ende des Kalten Krieges. Hat der Konflikt in der Ukraine Sie auf dem falschen Fuß erwischt?
Es schien ausgeschlossen, dass wir mehr als sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in nur wenigen Wochen mit einer Politik konfrontiert werden, die gewaltsam Grenzen verändert. Das darf kein Beispiel werden, weder in Europa noch sonst in der Welt.
Warum hat diese Krise Sie so überrascht?
Die Beziehungen zwischen der EU und Russland waren in den letzten fünfzehn Jahren von Höhen und Tiefen begleitet. Aber nach Jahren wachsender Wirtschaftskooperation mit Russland und einer nicht immer konfliktfreien, aber dauerhaften politischen Zusammenarbeit habe ich nicht mit der Rückkehr zu alten Mustern der Absicherung geopolitischer Räume mit militärischer Gewalt gerechnet.
Putin hat die Krim annektiert. Siegt die Macht über das Recht?
Auf der Krim ist das zweifellos der Fall. Russlands Vorgehen ist politisch inakzeptabel und völkerrechtswidrig. Es kommt nun darauf an, die zwischenstaatlichen Beziehungen in Europa nicht von Russlands Verhalten und seinen Folgen auf Dauer prägen zu lassen.
Der Westen hat bisher eher symbolische Sanktionen verhängt. Bleibt die Annexion der Krim folgenlos?
Nein, sie ist schon jetzt nicht ohne Folgen. Weder glaubt irgendjemand in Europa, nach der Annexion der Krim könnten wir mit Russland ohne weiteres zur Tagesordnung übergehen. Noch kann sich Russland selbst einreden, dass die Annexion folgenlos ist. Wirtschaftlich hat sich das schon gezeigt mit dem Einbruch auf den Moskauer Finanzmärkten, dem Fall des Rubels und der sich dramatisch beschleunigenden Kapitalflucht. Politisch sollte es Moskau zu denken geben, dass sowohl die Abstimmung im Sicherheitsrat wie in der Generalversammlung der Vereinten Nationen deutlich gemacht hat, dass seine Politik selbst von vielen regelmäßigen Unterstützern Russlands nicht mitgetragen wird.
Handelt Europa entschlossen genug?
Steinmeier: Ich finde Europas Politik richtig. Erstens, weil wir eine klare gemeinsame Haltung eingenommen haben. Zweitens, weil wir auf das Vorgehen Russlands nicht kopflos, sondern klug reagiert haben. Mit den dreistufigen Sanktionen lassen wir verschärfende Handlungsmöglichkeiten offen und verbauen uns nicht die Rückkehr zum Gespräch mit Russland.
Die Amerikaner wären mit den Sanktionen gern schneller und weiter vorangegangen. Warum bremsen Sie und die Bundesregierung?
Steinmeier: Es war doch eher so, dass die Amerikaner am Ende den europäischen Vorschlag des gestuften Vorgehens mitgetragen haben und selber weiter auf diesem Kurs sind. Aus ungezählten Treffen und Telefonaten weiß ich: John Kerry und ich teilen die gleiche Analyse der Lage.
Aber warum haben Sie sich nicht für stärkere Sanktionen eingesetzt?
Steinmeier: Wir haben Russland unsere klare Haltung deutlich gemacht und diese mit Sanktionen unterlegt. Es geht uns aber nicht darum, in einen Wettbewerb öffentlicher Erklärungen einzutreten und medialen Erwartungen Rechnung zu tragen, sondern in der Eskalation noch Wege offen zu halten, übrigens in beide Richtungen. Das steht hinter unserer Strategie. Ob sie aufgeht, werden wir in den Verhandlungen über eine Kontaktgruppe mit Vertretern der Ukraine, Russlands, der EU und der USA sehen. Russland kann keinen Zweifel daran haben, dass es mit einer deutlichen Reaktion zu rechnen hat, wenn es über die Krim hinaus ausgreift.
Deutschland ist bei der Kontaktgruppe, die sich an diesem Donnerstag in Genf zum ersten Mal trifft, nicht dabei. Verliert Berlin an Einfluss?
Nein. Ich selbst habe vorgeschlagen, dass nicht einzelne europäische Staaten der Kontaktgruppe angehören sollten, sondern wir eine möglichst kleine, vertraulich arbeitende Gruppe schaffen, die nicht schon beim ersten Zusammentreffen Pressekonferenzcharakter hat. Deshalb habe ich mich für eine Repräsentation Europas durch Catherine Ashton ausgesprochen. Ich habe dazu einen Brief an US-Außenminister Kerry geschrieben und ihm das erläutert.
Befürchten Sie, dass Russland auch in der Ostukraine interveniert?
Das wäre ein schwerer Fehler. Ich glaube übrigens nicht, dass es einen Masterplan und ein festes Drehbuch gibt, dem das russische Vorgehen folgt. Es spricht viel dafür, dass Russland das eigene Verhalten situativ fortentwickelt. Dabei ist Moskau auch getrieben von nationalen Stimmungen, die von der russischen Führung selbst gefördert wurden. Der Aufmarsch russischer Streitkräfte an der Grenze ist bedrohlich, die Bilder aus dem Osten der Ukraine sind es auch. Es ist deshalb so wichtig, dass wir Beobachter der OSZE in der Ukraine haben. Mit der Zahl der Beobachter sind wir noch nicht an der Obergrenze, aber unsere Informationslage ist schon jetzt wesentlich verbessert.
Inzwischen wird in der Ostukraine geschossen, es hat Tote gegeben. Auch werden öffentliche Gebäude besetzt.
Die Besetzung öffentlicher Gebäude durch gewalttätige und zum Teil bewaffnete pro-russische Demonstranten macht die Lage im Osten und Süden der Ukraine noch gefährlicher. Konfrontationen wie in Slawjansk, wo es Tote und Verletzte gegeben haben soll, bergen großes Eskalationspotenzial. Aber was wir dort bis jetzt sehen, ist kein Zusammenbruch der staatlichen Ordnung. Auch gibt es einflussreiche Menschen, die sich um Entspannung bemühen. Es wäre gut, wenn Russland sich vom gewaltsamen und widerrechtlichen Vorgehen der pro-russischen Demonstranten distanzieren würde. Das Risiko einer politischen Spaltung der Ukraine ist jedenfalls noch nicht überwunden.
Könnte Russland auch in Moldau intervenieren?
Wir haben Russland klar signalisiert, dass Aktivitäten jenseits der Krim in die Ostukraine, Südukraine oder Richtung Moldau für uns eine neue Qualität hätten, die die dritte Eskalationsstufe der Sanktionen auslösen würden.
Mancher im Westen sagt, die Ukraine sei nur durch einen Nato-Beitritt wirksam zu schützen.
Diejenigen, die das sagen, sollten sich zunächst einmal mit der Ukraine selbst befassen. Ich kenne die politisch Verantwortlichen aus vielen Begegnungen und Gesprächen und weiß daher, dass sie ganz andere Sorgen haben und wenig Interesse, die im eigenen Land hoch umstrittene Nato-Frage zum Gegenstand der politischen Debatte zu machen. Ganz offen gesagt: Ich sehe es nicht anders als der amerikanische Präsident, ich sehe die Ukraine nicht auf dem Weg in die Nato.
Sollte man die Russen darüber nicht eher im Ungewissen lassen? Die sagen uns ja auch nicht immer, was für sie außer Frage steht.
Es ist Journalisten ja nicht verboten, auf Fragen zu verzichten. Wenn Sie mich fragen, antworte ich so, wie ich das für richtig halte.
Die Nato hat sich nach Osten ausgedehnt, wissend um russische Sensibilitäten. War das der richtige Weg?
Die Geschichte rückwärts mit hypothetischen Annahmen, was wäre wenn, aufzurollen, hilft uns nicht weiter. Es gab und gibt Sensibilitäten – gerade auch bei Russland. Entscheidend ist doch, dass viele osteuropäische Staaten, die ihre Erfahrungen in der früheren Sowjetunion oder im Warschauer Pakt gemacht hatten, dem Bündnis angehören wollten. Es war richtig, ihnen diesen Schutz nicht zu verweigern. Leider ist es im NATO-Russland-Rat nicht gelungen, die unterschiedlichen Interessen und Erwartungen offen und aufrichtig auszudiskutieren. So oft ich dabei war, blieb das im protokollarischen Ritual hängen. Das war ein Fehler.
Was entscheidet über einen Nato-Beitritt? Dass die Bevölkerung mehrheitlich dafür ist?
Die Nato ist ein offenes Bündnis mit klaren Kriterien. Das bedeutet die Verpflichtung auf gemeinsame Werte und die Bereitschaft zu gemeinsamer Politik. Natürlich spielt die Haltung der Bevölkerung im beitrittswilligen Land eine ganz wichtige Rolle, aber die politische Gesamtlage auch.
Soll die EU der Ukraine die Mitgliedschaft in Aussicht stellen?
Die Ukraine hat jetzt den politischen Teils des Assoziierungsabkommens unterzeichnet. Damit ist sie in die EU-Nachbarschaftspolitik einbezogen. Als die Nachbarschaftspolitik Mitte des letzten Jahrzehnts konzipiert wurde, übrigens aus den Erfahrungen mit der Orangen Revolution, war die Vorstellung, dass wir für die Staaten, die nicht zur Mitgliedschaft anstehen, ein eigenständiges Instrument europäischer Politik brauchen. Sie war als Alternative gedacht, nicht als Vorbereitung der Mitgliedschaft. Aber selbstverständlich war die EU nie ein closed shop und ist es für die Zukunft auch nicht, wenn die Aufnahmefähigkeit der EU weiter besteht.
Die Assoziierung ist also nicht der letzte Schritt?
Noch hat die Ukraine ja nicht einmal das ganze Assoziationsabkommen unterzeichnet. Jetzt muss es doch darum gehen, die Ukraine als staatliche Einheit zu erhalten und ihr jede mögliche Unterstützung zur politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung zu geben.
Die EU will der Ukraine finanziell helfen. Besteht nicht die Gefahr, dass die EU-Hilfe gleich an Gazprom überwiesen wird?
Es stimmt, dass Russland lange Hebel in der Hand hält, mit denen es der Ukraine das Leben schwer, ja vielleicht sogar unmöglich machen kann. Aber Russland hat, wenn es Moskau nüchtern analysieren würde, von einem zusammen gebrochenen Staatswesen an seiner Westgrenze auch am meisten zu verlieren. Genau darum suchen wir das Gespräch mit Russland.
Was treibt Putin? Ist er ein Nationalist oder einfach ein Machtpolitiker, der zugreift, wenn sich ihm die Chance bietet?
Putin weiß mit Macht umzugehen und ist bereit, diese auch hart einzusetzen – nach innen und außen. Aber selbst Putin-Kritiker in Moskau argumentieren, dass er sich vom Westen immer wieder missverstanden fühle.
Sind seine Reaktionen deshalb verständlich?
Ich gehöre zu denen, die sich mehr Kooperation und weniger Konfrontation wünschen. Dennoch: Es gibt keine Rechtfertigung dafür, gewaltsam Grenzen zu korrigieren und so eine Büchse der Pandora mit unabsehbaren Folgen zu öffnen. Die Aushöhlung des Prinzips der territorialen Unversehrtheit zugunsten eines behaupteten Selbstbestimmungsrechts der Völker könnte am Ende für den Vielvölkerstaat Russland selbst am gefährlichsten werden. Es prallen außenpolitische Philosophien mit Wucht aufeinander und hindern uns daran, aufeinander zuzugehen: dort das geopolitische Denken in Einflusssphären in den Kategorien des 19. Jahrhunderts, bei uns in Europa ein Denken, das nationalen Ehrgeiz eher überwunden hat und freiwillig Souveränitätsverzicht zugunsten der europäischen Integration übt.
Putin hat den Zerfall der Sowjetunion die „größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ genannt. Akzeptiert er den Gang der Geschichte nicht?
Es spricht viel dafür, dass er Russland als nicht hinreichend wahrgenommen sieht, politisch und wirtschaftlich.
Sind sie enttäuscht von Ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow, der auf alle Ihre Vorschläge zur Lösung der Ukrainekrise nicht reagiert hat?
Enttäuschung ist keine Kategorie der Außenpolitik. Und wenn nach der Zustimmung zur OSZE-Beobachtermission auch noch der Ukraine-Vierer aus Russland, der Ukraine, den USA und Europa kommt, liege ich mit meinen Vorschlägen doch gar nicht so schlecht. Aber in der Tat: Ernüchtert bin ich darüber, dass wir in Europa 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs noch nicht so weit sind, mit unvermeidbaren Interessenkonflikten anders umzugehen.
Ist Ihre Politik der Zusammenarbeit mit Russland gescheitert?
Ich weiß nicht, warum manche geradezu begierig auf den Beweis des Scheiterns kooperativer Politikmodelle warten. Konfrontation und Selbstisolation sind kein Weg und schon gar kein Ausweg. Deshalb kann ich das heimliche Händereiben nicht verstehen. Die Krise ist tief, das Risiko einer neuen Spaltung Europas alles andere als gebannt. Ich kann nur davon abraten, unsere historischen Erfahrungen über Bord zu werfen. Wenn andere die Nerven verlieren, sollten wir kühlen Kopf bewahren.
Hat Putin der Nato ungewollt einen Gefallen getan, weil er sie mit der Annexion der Ukraine aus der Sinnkrise der vergangenen Jahre befreit hat?
Nicht der Nato. Aber uns in Europa hat es geholfen, die Bedeutung von Außen- und Sicherheitspolitik wieder zu entdecken. Die gegenwärtige Krise zeigt, dass eine in Jahrzehnten aufgebaute und scheinbar tragfähige Sicherheitsarchitektur der ständigen Absicherung und Erneuerung bedarf. Das verlangt eine aktive Außenpolitik. Die Krimkrise ist also keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Nato. Aber auch die Nato muss sich selbst prüfen und klären, ob sie die richtigen Schwerpunkte setzt.
Heißt das, Kommando zurück und Rückkehr zur klassischen Landesverteidigung in Europa nach den Diskussionen über weltweite Militäreinsätze?
Der Einsatz in Afghanistan nach Nine Eleven war nicht begleitet von der Vorstellung, in der ganzen Welt Menschen mit unseren Vorstellungen von Demokratie, Freiheit und Sicherheit zu beglücken. Es war ein Einsatz in einer Zeit, in der mehr als 3000 Amerikaner nach einem islamistischen Attentat gestorben sind und Europa die Befürchtung hatte, ähnliche Attentate könnten sich auch bei uns wiederholen. Tatsächlich haben sie in London und in Madrid stattgefunden. Wir wollten verhindern, dass durch den weiteren Ausbau der Trainingslager für Terroristen in Afghanistan Menschen in unserem Land zu Schaden kommen. Es ging um die Sicherheit Deutschlands und seiner Bündnispartner.
Deutschland gibt 1,4 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für den Verteidigungsetat aus. Das Nato-Ziel liegt bei 2 Prozent. Müssen wir mehr tun?
Die meisten Nato-Mitgliedstaaten sind weit entfernt von den selbst gesetzten Zielvorgaben. Auch wir. Weil wir weiter finanziell konsolidieren müssen, können wir uns auch nichts vormachen: Es wird sich auf wundersame Weise auch keine Schatulle öffnen, deren Inhalt uns in Nullkommanichts zu 2 Prozent führt. Wir müssen effizienter werden und mehr Arbeitsteilung vereinbaren, so wie das etwa beim Lufttransport in der Nato ganz ordentlich gelungen ist.
Ihr Amtsvorgänger stand für eine „Kultur der Zurückhaltung“. Sie selbst sagen, man könne das Weltgeschehen nicht „von der Außenlinie“ kommentieren. Was soll sich konkret an Deutschlands Außenpolitik ändern?
Ich habe nichts gegen die Kultur der Zurückhaltung, wenn sie militärisch verstanden wird. So sehen es alle Parteien im Deutschen Bundestag. Mir scheint allerdings bei der ständigen Wiederholung dieses Prinzips das Missverständnis entstanden zu sein, dass wir uns jenseits der militärischen Zurückhaltung auch außenpolitisch zurückhalten müssen. Das halte ich für falsch. Wir sind ein wenig zu groß und in der Staatengemeinschaft auch zu wichtig, als dass wir das Spiel nur von der Seitenlinie aus beobachten und klug kommentieren könnten. Auf uns ruhen mehr Erwartungen, als wir erfüllen können. Aber in den Bereichen, wo wir sie erfüllen können, müssen wir aktiver sein. Deshalb habe ich schon kurz nach Amtsantritt entschieden, dass wir uns an der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen und an der Waffensicherung in Libyen aktiv beteiligen; und der Versuch mit Laurent Fabius und Radek Sikorski, das Blutvergießen in Kiew zu beenden, gehört auch in diese Linie.
Deutschlands Verbündete haben Berlin immer wieder gefordert, militärisch mehr zu leisten. Geben Sie diesem Druck jetzt nach?
Wer glaubt, mehr Verantwortung in der Außenpolitik hieße mehr Militäreinsätze, unterliegt einem großen Missverständnis. Ich sehe für eine solche Debatte überhaupt keinen Anlass. Die Fakten sprechen eine andere Sprache: Wir bringen bis Ende 2014 dreitausend Soldaten aus Afghanistan nach Hause. Von den verbliebenen Missionen, an denen wir uns beteiligen, ist die Kfor-Mission auf dem Balkan die weitaus größte. Die Beteiligung an anderen Mandaten, insbesondere in Afrika, liegt weit darunter, unser Fokus liegt stark auf Ausbildung. Ich kann darin keine Militarisierung erkennen.
In der Europapolitik war das Kanzleramt in den vergangenen Jahren federführend, vom Auswärtigen Amt gingen wenig Impulse aus. Ist Europa Kanzlersache?
Wir können berechtigter Hoffnung sein, dass wir die wirtschaftliche Krise Europas überwinden können. Dennoch erleben wir zurzeit, dass die lange wirtschaftliche Stagnation Europa in eine Glaubwürdigkeitskrise gebracht hat. Das höhlt die Idee Europas aus. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass Europa von allen wieder als Quelle der Hoffnung verstanden werden kann. Zweitens müssen wir die Glaubwürdigkeitsdefizite auch durch ein stärkeres Zusammenwachsen von Europa beheben. Das ist keine Aufgabe, die irgendjemand in Berlin alleine bewältigen könnte. Neben dem Kanzleramt sehe ich andere Ministerien in der Pflicht, gerade auch das Außenministerium. Wir haben uns deshalb auch in der Europapolitik verstärkt.
Das Auswärtige Amt musste also erst wieder aus der Bedeutungslosigkeit zurückgeholt werden?
Harte Worte! Und nicht berechtigt. Aber ich glaube, das Auswärtige Amt hat etwas anzubieten, dem man Gehör verschaffen muss. Und dafür haben wir gesorgt. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen: Wir wollen im Laufe der nächsten 12 Monate im Auswärtigen Amt einen möglichst breiten Review-Prozess durchlaufen, mit Fachleuten, aber auch mit der breiten Öffentlichkeit in ganz Deutschland und dabei uns und anderen Fragen stellen und neue Antworten bekommen: Was sind die Erwartungen an moderne Außenpolitik? Sind wir richtig aufgestellt in einer Welt der neuen Unübersichtlichkeit? Ich erhoffe mir davon eine lebendige Debatte über die Bedeutung von Außenpolitik, und natürlich auch Ideen und Anstöße für unsere Arbeit.
Sie sind zum zweiten Mal Außenminister. Warum wollten Sie partout ins Auswärtige Amt zurück?
Steinmeier: Der erste Grund liegt auf der Hand. Ich hatte vier Jahre lang Außenpolitik gemacht, gern sogar, und nicht akzeptiert, dass in der Wahrnehmung vieler die Bedeutung von Außenpolitik gesunken war. Zweitens gibt es ein paar Dinge, bei denen ich den Eindruck hatte, gerade erst angefangen zu haben, Werkstücke, an denen ich weiter schmieden wollte. Und drittens ging es mir auch darum, dass Deutschland seinen Beitrag in der internationalen Politik sichtbarer und aktiver vorträgt. Wer immer geglaubt haben mag, dass Außen- und Sicherheitspolitik überflüssig geworden ist, hat Unrecht.
Die Fragen stellten Matthias Naß und Michael Thumann. Übernahme mit freundlicher Genehmigung der ZEIT.