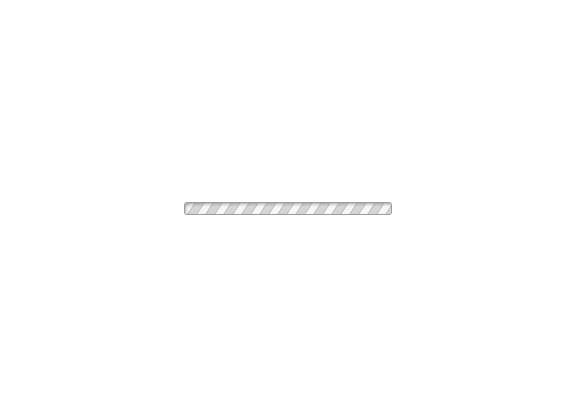Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
Rede von Guido Westerwelle bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.
Es gilt das gesprochene Wort!
Lieber Herr Dr. Oetker,
lieber Herr von Nordenskjöld,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich danke Ihnen für die Gelegenheit, in diesem renommierten Hause heute zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Meine Damen und Herren,
deutsche Außenpolitik gehört zu dem wertvollsten Inventar unserer Republik.
Immer wieder ist hierzulande zu hören von einer Abkehr der Menschen von der Politik.
Wenn in anderen Ländern charismatische Politiker wie der neue amerikanische Präsident an die Macht kommen, dann wird die Frage nach einem deutschen Äquivalent immer schnell gestellt. So schlecht können deutsche Politiker in den letzten 60 Jahren nicht gewesen sein, die geholfen haben, uns die längste Friedensperiode in der Geschichte unseres Landes zu sichern.
Deutsche Außenpolitik zeichnet sich aus durch viel Kontinuität und wenig Hakenschläge. Kontinuität nicht etwa verstanden als Ideenlosigkeit, sondern als Fortsetzung einer großen Erfolgsgeschichte. Alle demokratischen Parteien hatten in der Geschichte unserer Republik hieran ihren Anteil. Liberale Persönlichkeiten wie Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Otto Graf Lambsdorff und Klaus Kinkel haben hierzu wesentliche Beiträge geleistet. Deutsche Außenpolitik ist im Kern die Selbstverpflichtung auf Kooperation. Das Kooperationsmodell war Voraussetzung für die Aussöhnung nach Westen, für den Entspannungsprozess nach Osten und für die Deutsche Einheit. Seine Fortsetzung fand dieser Ansatz nach dem Ende des Kalten Krieges durch das konsequente Vorantreiben der europäischen Integration zur Überwindung der Teilung unseres Kontinents. Wir können stolz darauf sein, dass deutsche Außenpolitik hieran großen Anteil hatte. Das Kooperationsmodell ist längst zum europäischen Modell geworden.
Meine Damen und Herren,
nach der Wiedervereinigung fand Deutschland seine erste große außenpolitische Aufgabe in Europa. Nach dem Kalten Krieg benötigte unser Kontinent einen neuen Ordnungsrahmen, der ihm schließlich durch die EU gegeben wurde. Im globalen Maßstab aber war damals die Frage nach einer neuen Ordnung noch längst nicht beantwortet. Das Sinnstiftende, das jenseits des Bedrohlichen jahrzehntelang dem Kalten Krieg innegewohnt hatte, hatte sich aufgelöst. Aber aus dem Ende der alten Ordnung folgte nicht zwangsläufig eine neue. Ein Blick auf die damals in den USA geführten Debatten zeigt, dass auch noch weit in die 90er Jahre die Frage nach der zukünftigen Rolle der letzen verbliebenen Supermacht nicht geklärt war. Einzig unstrittig war, dass die USA den Weg würden vorgeben können. Isolationismus, „Weltpolizist“, Kooperationsmodell oder unilateraler Ansatz – alle Modelle lagen auf dem Tisch.
Dann kam der 11. September 2001 und die Frage war schnell entschieden. Fast acht Jahre lang war dieses Datum die entscheidende Bezugsgröße für die internationale Agenda. Heute sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir uns vom 11. September 2001 als entscheidenden Dreh- und Angelpunkt der internationalen Politik emanzipieren müssen.
Es geht nicht darum, den 11. September vergessen zu machen. Auch Deutschland hat daraus zu Recht außenpolitische Konsequenzen gezogen. Der Anti-Terror-Kampf wird eine wichtige Aufgabe bleiben. In Afghanistan brauchen wir aus wohlverstandenem Eigeninteresse den Erfolg, damit dieses Land nicht wieder zur Heimstätte international agierender Terroristen werden kann. Dazu muss Deutschland insbesondere bei der Polizeiausbildung seine übernommenen Verpflichtungen endlich erfüllen.
Aber die letzten Jahre haben eben auch gezeigt, dass die Fokussierung auf den sog. „Krieg gegen den Terror“ den Blick auf vieles verstellt hat: auf Themen jenseits der Terrorfrage, die für die Zukunft unseres Zusammenlebens von entscheidender Bedeutung sein werden. Auf notwendige Grundsätze und Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit. Und selbst auf die ethischen Grundlagen des eigenen inneren Zusammenhalts.
Meine Damen und Herren,
wenn Freunde durch falsche Entscheidungen ihren Kompass verlieren und auf Abwege geraten, dann ist das kein Grund für Schadenfreude. Im Gegenteil. Man hilft ihnen zurück und sucht gemeinsam den richtigen Weg. Die USA haben im sogenannten „Krieg gegen den Terror“ und im unilateralen Politikansatz ihren Kompass mehr als einmal verloren. Guantanamo und Abu Ghraib stehen in der Außenpolitik der USA symbolhaft für ein vorübergehendes Verlassen der uns verbindenden gemeinsamen Wertebasis, die uns, „den Westen“, auch heute noch definiert: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist universell und unteilbar.
Die neokonservative Administration von Präsident Bush hat die Erfahrung machen müssen, dass wirtschaftliche und militärische Stärke im Zeitalter der Globalisierung nicht automatisch mehr Macht gewähren, sondern vor allen Dingen größere Verantwortung auferlegen. Hans-Dietrich Genscher beschrieb den Grundirrtum des neokonservativen Politikansatzes zu Recht als „die gefährliche Illusion, ein Land könne Kraft seiner militärischen Stärke die globalen Regeln nach eigenem Ermessen bestimmen, ohne ihnen selbst unterworfen zu sein, und es könne die Regelverstöße nach eigenem Ermessen sanktionieren“.
Die Präsidenten George Bush sen. und Bill Clinton haben während ihrer Amtszeiten gemahnt, die USA sollten ihre Position nutzen, um eine neue Weltordnung zu schaffen, in der Amerika sich auch dann noch wohlfühlen könne, wenn es nicht mehr das stärkste Land der Welt sei. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entschied sich die Administration unter Präsident Bush jun. für einen anderen Weg, den des Unilateralismus. Das Prinzip war: Amerika geht voran und die Willigen sollten folgen. Statt auf die Stärke des Rechts setzten die USA auf das vermeintliche Recht des Stärkeren. Institutionell gesprochen: statt auf die Vereinten Nationen auf Koalitionen der Willigen und die Perspektive, die NATO zu einer Art „Ersatz-UNO“ der Demokratien dieser Welt umzubauen.
Ohne Zweifel bleibt die NATO auch in Zukunft für unsere Sicherheit unentbehrlich. Aber sie muss wieder zum zentralen Ort der politisch-strategischen Diskussionen zwischen Europa und Nordamerika werden. Ich hoffe sehr, dass mit dem Amtsantritt des neuen NATOGeneralsekretärs Anders Fogh Rasmussen die Chance zu einem Neuanfang genutzt wird.
Gerade sein Eintreten für die Pressefreiheit qualifiziert ihn, an der Spitze der NATO zu stehen.
Meine Damen und Herren,
es spricht für die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie, dass das amerikanische Volk die Fehler der Vergangenheit erkannt hat und sich mit Barack Obama für einen klaren Politikwechsel entschieden hat.
Wenn er in den vergangenen Wochen auf den Iran zugegangen ist, wenn er Russland für den Neustart in den bilateralen Beziehungen neue Abrüstungsinitiativen vorschlägt, und wenn er von dem Fernziel einer Welt ohne Atomwaffen spricht, dann wäre es vollkommen verfehlt, ihm Naivität vorzuwerfen. Letztendlich folgt er dem aus dem Entspannungsprozess bekannten Muster: Berechenbarkeit schafft Vertrauen, Vertrauen gibt Sicherheit und Sicherheit eröffnet politische Spielräume für Kompromisse und Reformen. Dieses Muster hat auch heute nichts an Aktualität verloren. Die Fähigkeit zu deeskalieren gehört zum unbedingt notwendigen Handwerkszeug jeder erfolgversprechenden Außenpolitik.
Am Ende jener Phase, die durch den 11. September 2001 definiert wurde, bekommen wir eine zweite Chance. Es geht um nicht weniger, als das politische Vermächtnis der Entspannungspolitik, also die Verpflichtung auf eine auf Kooperation angelegte Weltordnung, in das Zeitalter der Globalisierung zu übersetzen.
In einer Welt, in der Multipolarität längst Realität geworden ist, ist der kooperative Ansatz der beste Weg, um Sicherheit und Stabilität im globalen Maßstab zu erreichen.
Voraussetzung dafür, dass unsere Interessen und Werte auch zukünftig gewahrt bleiben, wird sein, dass der Westen als Gemeinschaft der aufgeklärten, rechtsstaatlichen Demokratien dieser Welt wieder zu Geschlossenheit zurückfindet und damit an Handlungsfähigkeit gewinnt. Wir brauchen den Westen gerade im Zeitalter der Globalisierung. Wir brauchen den Westen nicht als Burg, sondern als Leuchtturm. Als Orientierungspunkt für alle, die nach Freiheit streben, nach der Herrschaft des Rechts und nach Toleranz. Und wir brauchen den Westen zur Selbstbehauptung im globalen Wettbewerb.
Meine Damen und Herren,
die Weltwirtschaftskrise führt uns dramatisch vor Augen, dass an verstärkter globaler Kooperation im Zeitalter der Globalisierung kein Weg vorbeiführt.
Daraus ergibt sich nicht zuletzt die Notwendigkeit zur Anpassung multilateraler Organisationen. Die Stärkung der G-20 als Antwort auf die Wirtschaftskrise ist ein Beispiel für die Entwicklung multilateraler Wege in der Globalisierung. Szenen wie beim G-8-Gipfel in Heiligendamm, wo einige Staats- und Regierungschefs gerade einmal beim Abendessen teilnehmen durften, passen nicht mehr in unsere Zeit. Das Londoner G-20-Format ist angesichts der Herausforderungen unserer Zeit der richtige Weg.
Länder wie Indien, China, Brasilien und Südafrika müssen stärker in die Wahrnehmung regionaler und globaler Verantwortung eingebunden werden. Auch in der Sicherheitspolitik, auch in der globalen Umweltpolitik, bei Gesundheitsfragen und der Armutsbekämpfung muss dieser Weg gegangen werden.
Die aktuelle Krise erinnert uns daran, woraus sich Freiheit, Sicherheit und wirtschaftliche Stärke unseres Landes zu einem erheblichen Teil erklären: nämlich aus unserer internationalen Vernetzung. Es liegt in unserem nationalen Interesse, protektionistischen Tendenzen in jeder Form, wirtschaftlich, politisch und auch kulturell eine klare Absage zu erteilen. Und wenn ich zum Beispiel nach Südamerika blicke, dann zeigt sich, dass wir durchaus Potential haben, unsere Vernetzung in mancher Weltregion noch deutlich auszubauen. Südamerika ist hierzulande ein immer noch unterschätzter Kontinent. Wir leben vom Frieden in Europa. Wir profitieren vom Frieden in möglichst vielen Regionen der Welt. Wir benötigen zur Wahrung unseres Wohlstandes den freien Welthandel, die möglichst sichere und möglichst breit verteilte Zufuhr von Energie und Rohstoffen und sichere Handelswege. Wir leben von einer arbeitsteiligen Welt. Und wir haben ein großes Interesse daran, von ungeplanter und unkontrollierbarer Migration als Folge von Kriegen und Katastrophen verschont zu bleiben, aber zugleich eine offene Gesellschaft zu sein. Unser Interesse an einer globalisierten Welt verbindet sich für mich als Liberalen mit einer klaren Werteorientierung, deren Inhalte zurückgehen auf die Errungenschaften der Aufklärung. Zu diesem Wertespektrum gehört als unveräußerlicher und universell gültiger Kern unser Bekenntnis zu den Menschenrechten, das keinem Relativismus unterliegen darf.
Westliche Toleranz und aufgeklärter Liberalismus funktionieren nur, wenn sie der Intoleranz mit klarer Ablehnung begegnen. Regime, die Bürger steinigen oder ihren Mädchen Bildung verweigern, die Gefangene foltern oder unliebsame Nachbarn erpressen, die Glaubens- und Gewissensfreiheit mit Füßen treten oder Terror exportieren, müssen unseren Druck spüren. Die universell anerkannten Werte – wie der Respekt vor der Würde des Menschen – sind jene Grenze, ab der aus dem Prinzip der Nichteinmischung gemeinsame Verantwortung wird. Wer hier ehrlich auftritt, gewinnt mehr Glaubwürdigkeit als jener, der leisetritt und Deutschland im Ausland nur als oberster Handelsvertreter repräsentiert. Heinrich Böll hat uns ins Stammbuch geschrieben: Es gibt eine Pflicht zur Einmischung in die innere Angelegenheit der Menschenrechte.
Meine Damen und Herren,
Deutschland hat ein vitales Interesse daran, auf globale Trends nicht nur zu reagieren, sondern die Globalisierung selbst mit zu gestalten. Das gilt nicht nur für die ökonomische Dimension der Globalisierung. Wenn fernab von Deutschland Krankheiten wie die Vogelgrippe in Asien oder die Schweinegrippe in Mexiko ausbrechen, dann sind wir herausgefordert, dem zu begegnen. Wenn Länder wie das Afghanistan der 90er Jahre zur Heimstätte international agierender Terroristen werden, dann ergeben sich hieraus Risiken für unsere Sicherheit. Afghanistan ist nicht zuerst ein altruistischer Einsatz. Die Bundeswehr in Afghanistan schützt auch nationale Interessen und Werte.
Wenn Handelswege nicht mehr sicher sind, dann hat das spürbare Auswirkungen auf unsere Exportwirtschaft. Und wenn regional massive Eingriffe in das Ökosystem erfolgen, dann haben möglicherweise noch Generationen nach uns mit heute noch nicht absehbaren Folgen zu kämpfen.
Für alle diese Fragen gilt, dass kein Land der Welt sie alleine lösen kann. Wir müssen den Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam begegnen. Die Geschichte des europäischen Integrationsprojektes ist das beste Beispiel dafür, dass dies gelingen kann. Die Idee des gemeinsamen Europas hat uns 60 Jahre Freiheit in Frieden und Wohlstand gebracht.
Auf unserem Kontinent begann nach einer unfassbaren Katastrophe so etwas wie eine „Globalisierung im Kleinen“. Die Ausgangssituation für ein erfolgreiches Zusammenwachsen der Völker, Staaten und Kulturen auf unserem Kontinent war denkbar schlecht. Bevor der Weg des gemeinsamen Europas begann, gehörten übersteigerter Nationalismus, politische Systemgegensätze, Menschenrechtsverbrechen und Protektionismus mehr zur Regel als zur Ausnahme. Anders als wir es heute meist empfinden, waren Demokratie und Freiheit für die Menschen alles andere als selbstverständliche Realität. Weniger als die Hälfte der Staaten der heutigen EU waren 1945 souverän und demokratisch verfasst. Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie mussten sich auch in Europa erst Bahn brechen.
Meine Eltern sind Jahrgang 1930. Ihnen sollte in jungen Jahren beigebracht werden, dass Frankreich nichts anderes sei als Deutschlands natürlicher Erzfeind. Es wurde der Versuch gemacht, eine ganze Generation mit derartigen Weltbildern zu beeinflussen.
Ich selbst entstamme einer Generation, die noch gespürt hat, welch tiefe Wunden die katastrophalen Verirrungen der deutschen Geschichte im kollektiven Gedächtnis unsere Nachbarn hinterlassen haben.
Aufgabe der Generationen vor uns war es, die Aussöhnung mit unseren Nachbarn und die Integration Deutschlands in den Westen voranzubringen. Die Aufgabe meiner Generation ist es, die Aussöhnung und Überwindung der Teilung Europas auch Richtung Osten zu vollenden. Es ist eine unübersehbare Tatsache, dass das Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn der weiteren Vertiefung dringend bedarf. Ich will an dieser Stelle nicht die Debatte über das „Zentrum gegen Vertreibungen“ wieder eröffnen. Aber wir müssen feststellen, wie unterschiedlich diese Debatte in der Bevölkerung und den seriösen Medien in Deutschland und Polen geführt worden ist.
Das Projekt, das Walter Scheel und Willy Brandt mit ihrer Ostpolitik 1969 begonnen haben, bedarf noch genauso der Vollendung, wie dies mit der seit 1949 von Konrad Adenauer und Theodor Heuss verfolgten Politik in Richtung Westen gelungen ist. Auch hier ist Kontinuität gefragt.
In diesen Tagen werden wir des Öfteren daran erinnert, dass wir die Erfolgsgeschichte Europa nicht für selbstverständlich halten dürfen. Wir müssen sie immer wieder neu schreiben. Die EU hat sich in der Finanz- und Wirtschaftskrise bisher als Glücksfall erwiesen. Wenn es sie nicht schon gegeben hätte, hätte man sie spätestens jetzt erfinden müssen. Kein EU-Land wäre in der Lage gewesen, der Krise im Alleingang zu begegnen. Ohne den Euro hätte die Finanzkrise schnell zur Währungskrise werden können – mit fatalen Folgen für unsere Exportwirtschaft. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und ihre Orientierung an der Geldwertstabilität haben ihren Wert bewiesen. Und es hat sich auch gezeigt, wie wichtig der gemeinsame Markt für Wohlstand und Stabilität in Europa ist.
Klar ist aber auch: Der Test ist noch nicht bestanden. Die EU muss gerade in der Krise weiter geschlossen und entschlossen handeln. Sie muss gerade in der Krise an ihren Grundsätzen festhalten. Es ist eine der Lehren der großen Depression der Dreißigerjahre, dass Protektionismus und Abschottungspolitik fatale Folgen haben können. Diese Lehren müssen wir in der Europäischen Union zuallererst selbst beherzigen. Wer zwischen den Staaten der Europäischen Union wieder Handelsschranken errichten will, wer die Freizügigkeit beschränken will, wer den Startschuss für Subventionswettläufe gibt, wer Investitionen aus dem Ausland unter Genehmigungsvorbehalt stellt, der legt die Axt an die Wurzel des Einigungswerks. Alle in Europa wären gemeinsam die Verlierer.
Beunruhigend ist auch, dass in der EU ganz offenkundig die Bereitschaft der großen Staaten wächst, ohne Einbindung der kleineren Partner Fakten zu schaffen. Wer über die Köpfe der anderen hinweg Entscheidungen trifft, gefährdet auf lange Sicht die Idee des gemeinsamen Europas. Wir wollen in der Europäischen Union keine Achsenbildung.
Für den Erfolg der europäischen Einigung war das Verständnis, dass die EU-Staaten unabhängig von ihrer Größe gleichberechtigt und ebenbürtig sind, von entscheidender Bedeutung. In diesem Punkt bin ich Schüler nicht nur von Hans-Dietrich Genscher, sondern auch von Helmut Kohl.
In der Europapolitik ist Luxemburg so groß wie Frankreich.
Es ist eine liberale Grundüberzeugung, dass Größe in Europa nicht vor allem mehr Macht bedeutet, sondern mehr Verantwortung. Und es war über Jahrzehnte ein Grundpfeiler deutscher und liberaler Europapolitik, immer auch die Interessen der kleineren Mitgliedstaaten im Blick zu behalten.
Dennoch gehöre ich nicht zu denen, die davor zurückschrecken, in der Kategorie nationaler Interessen zu denken und solche auch zu formulieren. Es ist nicht lange her, da wurde noch regelrecht davor gewarnt, das nationale Interesse zum Maßstab deutscher Europapolitik zu machen. Dies scheint mir an der Sache vorbeizugehen. Was sollten wir denn sonst zum Maßstab machen? Unsere Partner in der EU definieren ihre Interessen ganz selbstverständlich. Als demokratische Regierungen sind sie ihren Bürgern dazu verpflichtet. Und ganz selbstverständlich erwarten sie gleiches auch von uns. Deutsche Außenpolitik muss werteorientiert und interessengeleitet sein.
In der Welt des 21. Jahrhunderts ist die Europäische Union vor allem eines: Sie ist der organisierte Ausdruck des Willens der Europäerinnen und Europäer zur Selbstbehauptung im weltweiten Wettbewerb um Werte und Einfluss. Nur sie gibt uns die Chance, in der Globalisierung erfolgreich zu sein. Deshalb wollen wir Liberalen eine starke, einige und selbstbewusste EU. Wir wollen eine EU, die eine aktive Rolle in der Welt spielt und ihrer Verantwortung für die großen Zukunftsfragen gerecht wird.
Diesem Anspruch ist die EU in den vergangenen Monaten nicht immer gerecht geworden. Insbesondere hat sie versäumt, frühzeitig mit neuen Ideen für gemeinsame Projekte auf die Administration von Präsident Obama zuzugehen. Die USA haben darauf geradezu gewartet und uns Angebote gemacht. Doch leider fehlte es in der EU zu oft an der erforderlichen Führung. Die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bleibt eine Geschichte verpasster Gelegenheiten und ungenutzter Potentiale.
Wenn wir uns nun fragen, wie es um die Europäische Union heute steht, fällt die Antwort nicht eindeutig aus. Ich habe den Eindruck, dass in der Krise bei vielen das Bewusstsein dafür gewachsen ist, welchen Wert es hat, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Andererseits gibt es oft Unmut über das, was in Brüssel entschieden wird. Die Bürger ärgern sich über Unsinn aus Brüssel genauso wie über Unsinn aus Berlin.
Bei manchem, was aus Brüssel an Bürokratie zu uns kommt, hält sich übrigens auch bei mir die Begeisterung in Grenzen.
Nur zu gerne wird bei unpopulären Entscheidungen mit dem Finger auf Brüssel gezeigt, auch wenn man diese Entscheidungen selbst zu verantworten hat. Auf der anderen Seite sollte manche europapolitische Frage besser dann beantwortet werden, wenn sie sich stellt und nicht, wenn sie im Wahlkampf nützt.
Blickt man einige Jahre zurück, stellt man fest, dass sich die EU in ein Dilemma hinein manövriert hat. Vor zehn Jahren stand die Gemeinschaft vor zwei großen Herausforderungen. Es galt, die Spaltung des Kontinents zu überwinden und die EU nach Mittel- und Osteuropa zu erweitern. Und es galt, die Handlungsfähigkeit der so erweiterten Union zu erhalten. Die bestehenden Institutionen, die für sechs Staaten geschaffen worden waren, waren für fünfzehn Staaten vielleicht gerade noch geeignet. Doch es war klar, dass sie für eine Union der 27 nicht mehr angemessen sein würden.
Jetzt stellen wir fest, dass die erste Herausforderung mit Bravour bewältigt wurde. Die Osterweiterung war ein Erfolg. Die bei einigen vorhandenen Befürchtungen haben sich nicht realisiert. Bei der zweiten Herausforderung sind wir hingegen kaum einen Schritt weiter gekommen. Der Vertrag von Nizza hat uns nicht entscheidend vorangebracht. Mit den Fragen, die damals nicht gelöst werden konnten, sind wir nun seit acht Jahren beschäftigt. Wenn die EU dem Anspruch, Problemlöser zu sein, gerecht werden will, braucht sie eine Erneuerung ihrer vertraglichen Grundlagen. Die EU muss verständlicher, demokratischer und handlungsfähiger werden. Darum brauchen wir den Vertrag von Lissabon.
Es wäre zu wünschen, dass wir in der Reformfrage endlich zu einem Durchbruch gelangen. Die EG und die EU haben in den vergangenen sechs Jahrzehnten schon so manch schwierige Phase durchlebt und überstanden. Es gab Krisen und Fehlschläge. Für mich ist entscheidend, dass der Wille der Mitgliedstaaten zur Fortführung des Einigungsprozesses ungebrochen ist. Solange dies so bleibt, besteht für mich kein Anlass zum Pessimismus.
Ich hoffe sehr, dass der Lissabonner Vertrag bald in Kraft tritt. Aber ob dies nun gelingt oder nicht: Wir werden in jedem Fall darüber nachdenken müssen, wie wir die Europäische Union in den kommenden Jahren weiter voranbringen können. Für mich ist klar, dass in einer Union mit 27 Mitgliedstaaten auch Modelle zulässig sein müssen, bei denen Gruppen von EUStaaten mit Projekten vorausgehen. Es ist immer besser, wenn notwendige Reformen der EU von allen Mitgliedstaaten gemeinsam erreicht werden. Aber wenn dies in der konkreten Situation nicht möglich ist, darf dies nicht zum Stillstand führen. Schon Hans-Dietrich Genscher hat in seiner Zeit als Außenminister erkannt: Kein Mitgliedstaat kann gezwungen werden, weiter zu gehen, als er es wünscht. Aber kein Mitgliedstaat darf zugleich die Möglichkeit haben, andere, die weiter gehen wollen, daran zu hindern.
Dabei kommt es darauf an, dass diese Formen engerer Zusammenarbeit von Staatengruppen offen bleiben für jene, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen wollen. Und es muss gewährleistet sein, dass das langfristige Ziel einer engeren Zusammenarbeit immer die vertiefte Integration der gesamten Union ist. Der Begriff der europapolitischen Avantgarde erscheint mir insofern durchaus angemessen.
Die gemeinsamen politischen Institutionen und Projekte sind jedoch nur das Eine. Mindestens ebenso wichtig ist die gegenseitige Verständigung. Damit meine ich nicht die Verständigung zwischen den Eliten, sondern die zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Die politisch vollzogene Erweiterung muss durch ein Zusammenwachsen der Gesellschaften dauerhaft verankert werden.
Zwischen Deutschland und Frankreich ist dies in herausragender Weise gelungen. Der Frieden zwischen unseren beiden Staaten hat seine Grundlage auch in unzähligen privaten Freundschaften. Die Arbeit des deutsch-französischen Jugendwerks hat für den Frieden in Europa vermutlich mehr bewirkt als so mancher Staatsgipfel mit Brückenbegehung. Unsere Aufgabe ist es, dass die gleiche Qualität in den Beziehungen endlich auch zwischen östlichen und westlichen EU-Mitgliedern erreicht wird. Ein besseres Verständnis der Deutschen und Polen für einander ist genauso Voraussetzung für den Erfolg der EU wie das gute Verständnis zwischen Deutschen und Franzosen.
Meine Damen und Herren,
der Blick auf den europäischen Integrationsprozess zeigt, dass Europa in den Globalisierungsprozess einen unvergleichbaren Erfahrungsschatz einzubringen vermag. Auch global gilt es, tiefe politische und kulturelle Gräben zu überwinden und Mechanismen der Zusammenarbeit zu schaffen, mit denen Chancen und Risiken gerecht verteilt werden. Dabei sind wir Liberale davon überzeugt, dass sich unsere Prinzipien von Rechtsstaat und Demokratie, einer sozialen Marktwirtschaft und dem Bekenntnis zu den Menschenrechten langfristig auch global als die besten Garanten für Stabilität und Verlässlichkeit erweisen und deshalb auch durchsetzen werden.
Meine Damen und Herren,
der Kooperationsansatz wird auf globaler Ebene nur dann funktionieren, wenn verloren gegangenes Vertrauen wieder hergestellt werden kann.
Einer der Ansatzpunkte einer solchen Politik liegt in einer konsequent betriebenen Politik für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Nukleare und konventionelle Rüstungskontrolle, die den Kalten Krieg überwinden half, ist heute massiv geschwächt. Die Konsequenzen sind ein tiefgehender Vertrauensverlust, neue Gefahren für die weltweite Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und damit ein wachsendes Risiko für die globale Sicherheit und Stabilität.
Es ist Zeit für eine Renaissance der Abrüstungspolitik. Anfang 2007 haben vier große amerikanische Staatsmänner, Henry Kissinger, George Shultz, Wiliam Perry und Sam Nunn, die Forderung nach dem vollständigen Verzicht auf Nuklearwaffen erhoben. Anfang 2009 haben in Deutschland Hans-Dietrich Genscher, Richard von Weizsäcker, Egon Bahr und Helmut Schmidt diese Initiative aufgenommen. Präsident Obama hat sich dieses Thema gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft auf die Fahnen geschrieben und Russland scheint diesen Weg mitgehen zu wollen. Dabei ist klar: wer die nukleare Abrüstung will muss auch die konventionelle Abrüstung wollen.
Ich habe bei meinen gerade zurückliegenden Gesprächen in Moskau das klare Interesse von russischer Seite an weitreichenden Abrüstungsschritten signalisiert bekommen. Es ist nicht von primärer Bedeutung, ob es die Kassenlage ist, die Russland hierzu bewegt, oder ob andere Gründe dahinter stehen. Auch das Konzept der Perestroika hatte ohne Zweifel auch ökonomische Hintergründe. Was am Ende zählt, ist das Ergebnis. Wenn sich jetzt die Möglichkeit ergibt zu neuen umfassenden Abrüstungsvereinbarungen, dann muss diese Chance ergriffen werden.
Der Abzug der verbliebenen taktischen US-Nuklearwaffen aus Deutschland wäre eine angemessene Reaktion auf diese Dynamik. Kaum ein anderes Land auf dieser Welt kann so glaubhaft wie Deutschland für den Verzicht auf Nuklearwaffen werben. Unser Land ist ein Beispiel dafür, dass Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und politischer Einfluss auch ohne die nukleare Option realisierbar sind. Deshalb muss sich Deutschland wieder an die Spitze jener Staaten stellen, die der nuklearen Nichtverbreitung ihre ganze Aufmerksamkeit widmen.
Meine Damen und Herren,
Russland wird auch jenseits der Abrüstungsfragen in der deutschen Außenpolitik immer einen herausgehobenen Platz einnehmen. Wir Liberalen übersehen nicht die Besorgnis erregenden Tendenzen. Bei aller berechtigten Kritik gilt: Deutschland braucht und will die Partnerschaft mit Russland. Wir wollen sie außenpolitisch und auch wirtschaftlich. Genauso klar sage ich: Wer glaubt, Stabilität auf Kosten des Rechtsstaats generieren zu können, wird irgendwann feststellen, dass er Instabilität gesät hat.
Diese Brücke aus Kritik und Kooperation zu schlagen, ist nicht immer einfach, aber sie gehört unbedingt zu einer Außenpolitik, die zugleich Interessen verfolgt und sich zu Werten bekennt.
Meine Damen und Herren,
hohe öffentliche Aufmerksamkeit erfährt Außenpolitik immer dann, wenn sie zur Krisenpolitik wird – wenn die Bundeswehr eingesetzt werden muss, wie in Afghanistan, wenn Konflikte aufbrechen, wie im Nahen Osten, wenn Rohstofflieferungen gestört werden, wenn es gilt, die Folgen von Naturkatastrophen abzumildern, oder wenn schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen werden. Die Tagesaktualität ist die eine, gerade für die Medien reizvolle Seite der Außenpolitik. Die großen Herausforderungen der Zukunft kommen weniger dramatisch daher, aber sie haben das Potential, unser Leben mindestens ebenso langfristig zu beeinflussen. Bildung, Energie, der Zugang zu Rohstoffen und Wasser, Nahrungssicherheit, der Klimawandel, die demographische Entwicklung und Gesundheitsfragen sind die eigentlich entscheidenden Faktoren der Zukunft.
Auf lange Sicht ist Bildung die vielleicht wichtigste dieser Ressourcen. Bildung schützt vor Diskriminierung und Unterdrückung, sie ist Katalysator der Freiheit. Bildung sichert den Frieden. Bildung mündet in Produkte. Bildung schafft Märkte. Bildung ermöglicht Wohlstand. Bildung bekämpft den Klimawandel. Bildung findet neue Energiequellen. Bildung ist die soziale Frage der Zukunft. Kreativität und Erfindungsreichtum sind prinzipiell überall vorhanden. Der Wettlauf um die beste Bildung ist der demokratische Kern der Globalisierung. Über den künftigen Wohlstand der Nationen wird der Wettbewerb um das beste Bildungssystem noch mehr entscheiden als der Wettbewerb um das beste Steuersystem. Für uns in Deutschland heißt das, dass wir international ausgerichtete und wettbewerbsfähige Bildungsangebote ausbauen müssen. Regierungen kommen und gehen. Aber wer als junger Deutscher auch im Ausland gelernt hat, der bleibt ein Leben lang Weltbürger. Und wer als junger Ausländer in Deutschland gut und gastfreundlich gelernt hat, der bleibt ein Leben lang Anwalt Deutschlands. Auf diese internationale Verflechtung zu verzichten, wäre eine Verschwendung von Geist, gegenseitigem Verständnis und auch von Kapital. Bestehendes Kapital in diesen Bereichen müssen wir ausbauen. Investitionen in die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und in die Weltoffenheit unserer Gesellschaft sind Investitionen in die Zukunft. Es ist wohltuend, dass der Auswärtigen Kulturpolitik inzwischen wieder mehr Gewicht beigemessen wird. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Kulturelle Verflechtung nach außen und Weltoffenheit nach innen gehen Hand in Hand. Eine weltoffene Gesellschaft ist die beste Grundlage für eine erfolgreiche Außenpolitik.
Genauso wie Außenpolitik muss Entwicklungszusammenarbeit werteorientiert und interessengeleitet sein. Wie jedes andere Politikfeld auch, muss auch die Entwicklungszusammenarbeit laufend auf ihre Effizienz und Wirksamkeit überprüft werden. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass wir gerade in der Entwicklungszusammenarbeit mehr Transparenz brauchen, dass wir flexibler werden müssen, und dass wir mehr Hilfe zur Selbsthilfe leisten müssen.
Es ist nicht Aufgabe deutscher Entwicklungshilfe, dort Machthaber zu stabilisieren, wo Regierungen dauerhaft Menschenrechte verletzen. Deswegen müssen die Empfängerländer deutscher Entwicklungshilfe stärker an Kriterien der guten Regierungsführung gebunden werden. Und auch dies gilt es international abgestimmt zu tun, damit Geberländer nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Das gilt auch für einen Bereich, auf den wir als FDP in der Entwicklungszusammenarbeit immer besonderen Wert gelegt haben, nämlich auf den Kampf gegen HIV/AIDS. In Gebieten wo sich diese und andere Krankheiten massenhaft ausbreiten, drohen mittelfristig Risiken auf anderen Ebenen, die dann kaum mehr beherrschbar sind. Deshalb müssen wir hier einen Schwerpunkt setzen.
Meine Damen und Herren,
das europäische Kooperationsmodell, das deutsche Außenpolitik bis heute so erfolgreich gemacht hat, ist im Zeitalter der Globalisierung das erfolgversprechendste Konzept. Die Stärke Deutschlands in der Welt hängt eben nicht zuerst mit der Truppenstärke zusammen, sondern mit diplomatischer Klugheit, mitmenschlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Kraft. Das macht vor allem anderen unsere politische und moralische Autorität aus. Der Westen ist nach unserer Auffassung eben keine geografische Bezeichnung, sondern eine Wertegemeinschaft. Und nur wenn diese Werte in unserem Innersten zu jeder Stunde klar sind, können wir in der Völkergemeinschaft bewirken, was allen dient: Frieden in Freiheit.
Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.