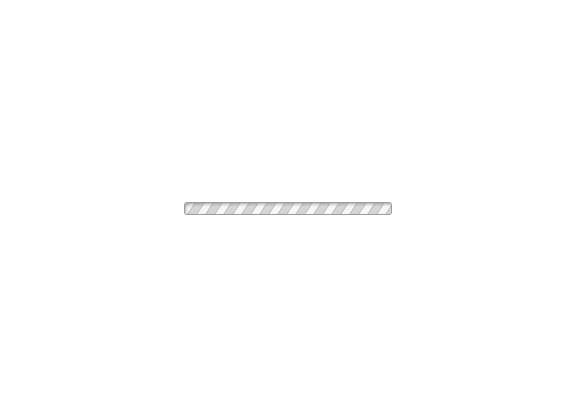Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Friedenspolitisches Handeln vor dem Hintergrund regionaler und globaler Herausforderungen“
Frieden muss geschaffen, erhalten, gestaltet werden. Das Engagement der vier deutschen Friedensnobelpreisträger stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Universität Bremen und der Deutschen Stiftung Friedensforschung in Bremen. Staatsminister Gernot Erler betonte: „Mehr denn je werden Dialog und Kooperation, Vernetzung und Verflechtung Richtschnur unserer Politik sein müssen.“
Rede von Staatsminister Erler bei der Konferenz „Wege zur Friedenssicherung und Versöhnung: Deutsche Friedensnobelpreisträger als Leitfiguren für die heutige Friedenspolitik“ am 12. April 2008 in Bremen
-- Es gilt das gesprochene Wort!--
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Böhrnsen,
sehr geehrter Abgeordneter Volker Kröning
sehr geehrter Professor Kloft,
sehr geehrter Wolf-Michael Catenhusen,
ich freue mich, heute Abend hier im Bremer Rathaus zu sein und zum Abschluss dieser Veranstaltung, die den deutschen Friedensnobelpreisträgern gewidmet ist, sprechen zu können.
Die Hansestädte sind ein gutes Pflaster für Friedenspolitik und Friedenspolitiker – Carl von Ossietzky, Ludwig Quidde, und Willy Brandt waren von Geburt Hanseaten, darauf ist mehrfach bereits Bezug genommen worden. „Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden“ heißt es ja bei Schiller.
Handel und Wandel brauchen Friedfertigkeit und Bürgersinn – das galt gestern so sehr wie es heute gilt: Je mehr Staaten miteinander umgehen, verflochten sind, Handel treiben, je mehr sie ökonomisch interdependent sind, desto unwahrscheinlicher wird Krieg zwischen ihnen.
Sie mögen sagen, das sei sehr vom Ende her, sehr realpolitisch gedacht.
Aber Friedenspolitik ist genau das! Wie Willy Brandt so treffend gesagt hat: „Ich begreife eine Politik für den Frieden als wahre Realpolitik dieser Epoche“.
Dieses Wort fasst zusammen, was sich wie ein Leitmotiv durch Leben und Wirken aller großen Friedenspolitiker, auch der deutschen Nobelpreisträger, zieht:
Frieden – und was wir tun können, um ihn zu sichern - ist sicher ein moralisches Postulat, Maxime der Friedensgesinnung und philosophischer Reflexion.
Aber Frieden ist keine Schwärmerei! Frieden ist nicht, sich bei eklatantesten Menschenrechtsverletzungen und Sicherheitsgefährdungen „in die Büsche zu schlagen“ - ich sage das ganz bewusst mit Bezug auf die aktuelle Diskussion um deutsche Auslandseinsätze.
Frieden muss geschaffen, erhalten, gestaltet werden – und das geschieht nicht in den lichten Höhen politischer Vision, sondern in der vielfach beschwerlichen Ebene politischer Praxis.
Wegweisende Friedenspolitik heißt gerade, die großen Visionen und die Hoffnung vom „Frieden auf Erden“ auf die konkreten Realitäten unserer Zeit, auf die spezifischen Konflikte und Spannungen herunterzubrechen und dort wirksam und gestaltmächtig werden zu lassen.
Ein solcher politischer Anspruch zielt deutlich mehr als nur auf die Abwesenheit von Krieg. Es ist eine politische Gestaltungsaufgabe von höchsten Ansprüchen – vielleicht die anspruchsvollste für handelnde Politiker überhaupt.
Friedenspolitik in diesem Sinne ist deshalb – auch das hat Willy Brandt gesagt - der eigentliche „Ernstfall“ unserer Außenpolitik – und in genau diesem Sinne haben ihn die großen Friedenspolitiker, nicht zuletzt die Friedensnobelpreisträger aus Deutschland, verstanden.
Lassen Sie mich das aus der Sicht der praktischen Politik erläutern – mit einem kurzen Blick zurück, dann mit einem Ausblick nach vorne.
Zunächst der Blick zurück:
Deutsche Nachkriegspolitik auf einen Nenner gebracht – man könnte sagen, das ist die beiden Begriffe „Deutschland“ und Frieden unauflöslich miteinander verbunden zu haben. Das Ringen um Entspannung, Rüstungsabbau und Zusammenarbeit, um europäische Selbstbehauptung und realistischen Ost-West Ausgleich ist zum Markenzeichen dieser Politik geworden. Ein enormer Kontrast zu dem, was vorher war!
Diese Politik hat – das erkennen inzwischen ja auch diejenigen an, die sie seinerzeit kritisiert haben – den Frieden in Europa unter schwierigen Bedingungen sicherer gemacht. Sie hat in Mittel- und Osteuropa neue Möglichkeiten und Freiräume eröffnet. Sie hat entscheidend dazu beigetragen, die Blockkonfrontation zu überwinden.
Nun ist der Kalte Krieg heute Geschichte. Das aber, was zwischen 1989 und 1991 begann und was den Kontinent so fundamental verändert hat, das spüren wir bis heute. Ein Blick auf die Landkarte reicht, um zu wissen, wovon ich rede.
Nehmen wir die Europäische Union. Es ist nicht abwegig zu sagen, dass die europäische Einigung die größte Friedensleistung der Europäer seit dem Westfälischen Frieden sei. Das gilt vor allem auch für die Erweiterung der EU um die Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas.
Die EU-Erweiterung ist nicht nur ein Integrationserfolg, sie ist ein Entwicklungsmodell. Anderen politischen Räumen ist in beispielhafter Weise gezeigt worden, wie viele Kräfte freigesetzt werden, wenn es zu echter Demokratisierung und zur Einrichtung von funktionierenden, rechtsstaatlichen Marktwirtschaften kommt. Und was für eine Attraktivität ausgelöst wird, wenn man innerstaatliche Prinzipien wie die der Solidarität, der Chancengleichheit und von annähernd gleichem Lebensstandard zur Grundlage einer Staatengemeinschaft macht.
Die Erweiterung der EU ist „transformationelle Friedenspolitik“ par excellence. Länder, die über Jahrzehnte im leeren Winkel des Blockdenkens lagen, kehrten zurück in den europäischen Verbund, zu europäischen Prinzipien und Werten, einschließlich der Maxime, Nachbarschaftskonflikte und Minderheitenprobleme friedlich zu lösen.
Das Erfolgsmodell der EU – Ausgleich und Harmonisierung von Interessen, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit – hat Ausstrahlungswirkung weit über die EU hinaus - gerade bei unseren Nachbarn und Partnern weiter im Osten. Die Ausweitung der Stabilitätsräume – durch Erweiterung, Europäische Nachbarschaftspolitik, strategische Partnerschaften – erhöht nicht nur unsere Sicherheit, sondern stärkt auch die unserer Partner. Das ist ein Teil der „Friedensdividende“, die zu Beginn der 90 er Jahre in aller Munde war.
Damit geht auch für die EU eine Zeit zu Ende, wo sie sich als Club von Privilegierten auf ihre erfolgreiche Selbstorganisation beschränken konnte. Von so einem Club mit 27 eher wohlhabenden Ländern und fast 500 Millionen Menschen wird automatisch mehr als Selbstorganisation verlangt – nämlich Verantwortung über den Rahmen der eigenen Staatenfamilie hinaus zu übernehmen!
Dazu kommt, dass wir feststellen müssen, dass nicht alles, was in der Euphorie der frühen 90er Jahre so greifbar und so nahe schien, tatsächlich erreicht worden ist.
„Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Freiheit“ sollte anbrechen – so 1990 die Charta von Paris für ein neues Europa. Eine gerechte, gesamteuropäische Friedensordnung vom Atlantik bis nach Wladiwostok – dieses große Ziel seit Ende des Zweiten Weltkrieges – sollte Wirklichkeit werden.
Der Weg dahin hat sich jedoch als schwieriger erwiesen, als so manch einer das vielleicht erwartete.
Es gab Missverständnisse und wohl auch gegenseitige Überforderungen. So etwa in den Beziehungen zu Russland. War die Grundannahme unmittelbar nach 1989, dass ein demokratisch transformiertes Russland über kurz oder lang ein aktiver Mitgestalter einer gemeinsamen europäischen Sicherheitsarchitektur werden würde, so bleiben die Ergebnisse bislang hinter den Erwartungen zurück.
Bis heute erleben wir immer wieder den Rückfall in alte Denkmuster. Das vor dem Hintergrund, dass Russland ziemlich geräuschvoll wieder auf die Weltbühne zurückgekehrt ist und seine Rolle als souveräne Energiegroßmacht, an der niemand vorbei kommt, ohne Zögern ausspielt.
Dann sieht man doch noch, welch lange Schatten der Kalte Krieg mitunter noch wirft: statt Dialog und Normalität viel zu oft Abgrenzungsrhetorik oder sogar Konfrontation. Dies ist gerade an der Entwicklung des letzten Jahres 2007 gut ablesbar.
Neue Spannungen und ungelöste Konflikte lassen viele gar zweifeln, ob das Ziel einer gesamteuropäischen Friedensordnung überhaupt realistisch ist. Nun wäre es naiv, die Schwierigkeiten zu verkennen. Dennoch sage ich entschieden: Wir müssen an diesem Ziel festhalten, wenn wir den Frieden in Europa sichern wollen.
Frank-Walter Steinmeier und Hans-Dietrich Genscher haben an das Erfordernis einer engen Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland, der EU und Russland, und den USA und Russland, erst vor wenigen Tagen erinnert. Es geht um eine kooperative Weltordnung. Die EU auf der einen Seite, Russland auf der anderen, sind in vielfacher Weise aufeinander angewiesen. Sie haben sich ebenso viel zu bieten. Das bleibt bestehen, und daran müssen wir festhalten, auch wenn die Zeiten mitunter schwieriger geworden sind.
Ich denke, wir sollten den zukünftigen russischen Präsidenten gerade jetzt beim Wort nehmen! Medwedjew spricht von der EU als dem unverzichtbaren Modernisierungspartner für Russland! Und von der schlichten Unumgänglichkeit von Demokratie/Rechtsstaatlichkeit und starker Zivilgesellschaft bei diesem Prozess! Nehmen wir sein Angebot der Partnerschaft an! Der Wandel in Russland – das ist sein, das ist aber genauso unser Interesse.
Es gibt eine zweite, ebenso fundamentale Erfahrung, die das Imperativ europäischer Friedenspolitik seit 1989 dramatisch vor Augen geführt hat: die Erfahrung der blutigen Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren.
Erinnern wir uns: Krieg im Herzen Europas, vier Mal Krieg wenige Jahre nach der Charta von Paris, Krieg trotz jener europäischen raison d’etre nach 1945: „Nie wieder Krieg, nie wieder Gewaltherrschaft“. Es war ein Schock und das brennende Gefühl, versagt zu haben.
Europa musste hierauf reagieren!
Das Jahr 1999, unter der Eindruck des Kosovokrieges, markiert die eigentliche Geburtsstunde einer neuen europäischen und damit auch deutschen Sicherheitspolitik. Seitdem haben die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP) und die „Europäische Verteidigungspolitik“ (ESVP) kontinuierlich an Kontur gewonnen - bis heute, einschließlich des Aufwuchses an Fähigkeiten – ziviler wie auch militärischer.
Das war kein einfacher Prozess, und ist es weiterhin nicht. Doch die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen bis heute ist: Seit dem wegweisenden europäischen Rat in Köln 2003 gab es 19 verschiedene ESVP-Missionen, wobei mehr als 2/3 ziviler Natur waren, also Operationen vor allem im Polizei- und Rechtsstaatsbereich.
Komplementär zur Politik der Konfliktprävention haben die Europäer Anreize zum Interessenausgleich und zur Deeskalierung von Konflikten entwickelt. Ich nenne vor allem den auf deutsche Initiative gestarteten „Stabilitätspakt für Südosteuropa“, der Anfang dieses Jahres in einen Regionalrat umgewandelt worden ist – verbunden mit der Zusage der EU-Beitrittsperspektive an die Westbalkanstaaten durch den Europäischen Rat in Thessaloniki seit Juni 2003. Das war quasi eine verspätete Übertragung des friedenspolitischen Erfolgskonzepts der Erweiterungsoption für Mittelosteuropa auf das krisengeschütterte Südosteuropa.
Gewiss, nicht aller Konfliktstoff auf dem Balkan konnte damit weggeräumt werden. Der Disput um den Kosovo etwa beschäftigt uns bis heute, wie im Februar, bei der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos, erneut zu sehen.
Doch klar ist, dass eine langfristige Befriedung, gerade auch unter Berücksichtigung der Situation in Serbien, nur unter europäischen Vorzeichen vorstellbar ist: Konfliktauflösung und Friedensstiftung durch Integration – der klassische modus operandi der EU seit den Tagen der deutsch-französischen Versöhnung nach 1945. Einmal mehr ist die europäische Perspektive die definitive Friedensperspektive in Europa.
Eine Friedensbedrohung anderer Art, aber mit ähnlich weit reichender Dimension, war der 11. September 2001. Wir alle haben miterlebt, wie sehr das unsere Welt verändert hat.
Die Antwort der USA lässt sich in drei Worten zusammenfassen: „War on terror“.
Demgegenüber haben die Europäer differenzierter reagiert und auch gefragt – ich meine zurecht - was eigentlich die Ursachen terroristischer Gewalt sind und was dagegen zu tun ist.
Dementsprechend ist in der Europäischen Sicherheitsstrategie vom Ende 2003, die leider nie die Aufmerksamkeit gefunden hat, die sie verdient, ein umfassender – nicht schwerpunktmäßig auf Militär und Eskalation setzender Sicherheitsbegriff zugrunde gelegt worden. Der Titel gibt schon den Ton an: „Ein sicheres Europa in einer besseren Welt“. Was schon die Botschaft enthält: Nur eine gerechtere Welt mit einer fairen Weltordnung, wird uns in Europa in Sicherheit leben lassen.
Die wesentlichen Prinzipien europäischer Sicherheitspolitik, wie sie dort niedergelegt sind – Vorrang für Verhandlungslösungen, effektiver Multilateralismus, das Völkerrecht als Legitimationsgrund, der Einsatz für eine bessere, gerechtere Weltordnung, und folglich: militärische Intervention nur als allerletztes Mittel – sind die Doktrin einer „Zivilmacht“.
Verglichen mit dem Zustand zu Beginn der Balkankriege, ist das ein Quantensprung. Es zeigt, was sich seitdem verändert und entwickelt hat. Vieles davon in die richtige Richtung.
Europa hat jetzt Fähigkeiten, vorausschauende Friedenspolitik zu betreiben. Nicht zuletzt durch deutsches Zutun – wie zuletzt wieder im Ringen um den Reformvertrag erwiesen, der Anfang nächsten Jahres hoffentlich überall ratifiziert sein wird.
Wir haben in der EU jetzt allmählich auch ein gewandeltes Selbstverständnis., das nicht mehr nur auf den eigenen Kirchturm starrt, sondern die Verantwortlichkeiten einer Gemeinschaft von 500 Millionen Menschen in den 27 reichsten Ländern des Planeten annimmt.
Wie gesagt, das ist viel, aber sicher sind Erwartungen auch unerfüllt geblieben. Defizite sind unverkennbar, ich will das nicht schön reden. Wir wissen, dass die europäische Handlungsfähigkeit noch längst nicht ausreicht, um den immer häufiger werdenden Anforderungen nach europäischen Krisen- und Konfliktmanagement auch in sehr weit von Europa entfernten Regionen gerecht zu werden.
Diese Anforderungen – das ist abzusehen – werden weiter wachsen. Weltweit. Schon allein, weil in der zunehmend globalisierten Welt nicht nur Kommunikation, Kapital und Kommerz keine geographischen Grenzen mehr kennen, sondern auch die Konflikte nicht.
Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, dem Ausblick nach vorne. Was bedeuten die Erfahrungen der letzten zwei Jahrzehnte für eine Friedenspolitik des beginnenden 21. Jahrhunderts?
Meine Antwort ist eindeutig: Mehr denn je werden Dialog und Kooperation, Vernetzung und Verflechtung Richtschnur unserer Politik sein müssen.
Die großen Zukunftsfragen lassen uns gar keine andere Wahl. Klimaschutz, Energie- und Ressourcensicherheit, Demographie, regionale Verwerfungen und prekäre Staatlichkeit – all das müssen wir dringend gemeinsam angehen. Niemand kann das im Alleingang! – selbst der stärkste nicht, selbst die USA nicht, die das jetzt – in der Endphase der Ära Bush, bei Stichworten wie Irak, Rezession, Dollarverfall – selbst feststellen müssen.
Vorausschauende Friedenspolitik muss darauf setzen, Schritt für Schritt eine Politik gestaltender Zusammenarbeit zu entwickeln. Deutschland steht hier – gerade wegen des großen Vermächtnisses seiner Friedens- und Entspannungspolitik – in einer besonderen Verantwortung. Und diese Verantwortung, gerade auch innerhalb der EU, ist seit Ende des Kalten Krieges nicht kleiner, sondern größer geworden.
Dazu gehört, gerade auch mit schwierigen Partnern zu reden. In einer Welt, die politisch und ökonomisch zusammenrückt, kann Abwendung und Sprachlosigkeit keine Antwort sein. Das gilt insbesondere für die Regionalkonflikte, die uns beschäftigen – etwa im Nahen und Mittleren Osten oder mit Bezug auf das iranische Nukleardossier: Miteinander zu reden ist das Mindestmaß einer Lösung.
Drei Themenfelder möchte ich kurz streifen, die mir besonders für eine politische Friedensagenda wichtig erscheinen:
Erstens: Abrüstung und Rüstungskontrolle.
Immer mehr Staaten erlangen Zugang zu Nukleartechnologie oder können sogar Atomwaffen herstellen. Dieser Trend muss gestoppt werden, um eine Rüstungsspirale zu verhindern, die außer Kontrolle geraten könnte.
Abrüstung und Rüstungskontrolle müssen deshalb wieder ganz nach oben auf die politische Agenda. Deutschland wird daher weiter dafür eintreten, den Nichtverbreitungsvertrag wirksam zu halten und wo nötig anzupassen. Deshalb auch unser starkes Engagement – gemeinsam mit den UN-Vetomächten – zur Verhinderung einer iranischen Nuklearrüstung.
Außenminister Steinmeier hat ein internationales Anreicherungszentrum unter Kontrolle der Wiener UN-Atombehörde vorgeschlagen. Nur so können wir eine Vielzahl von nationalen Anreicherungsaktivitäten verhindern, mit nahezu unkontrollierbaren Proliferationsrisiken.
Zweitens, Klima- und Energiepolitik.
Das ist ein immer wichtiger werdendes Feld, wo wir Verantwortung und zusammen mit unseren Partnern globale Führung übernehmen müssen.
Während unserer EU- und G 8- Präsidentschaft im vergangenen Jahr haben wir dazu substantielle Beschlüsse auf den Weg gebracht: verpflichtende Reduktion von Treibhausgasen, mehr Energieeffizienz, ein Emissionshandelssystem ICAP zur Förderung eines globalen Kohlenstoffmarktes. Das alles geht maßgeblich auf deutsche Vorarbeiten zurück.
Der jüngste Europäische Rat im März hat die sicherheitspolitischen Implikationen des Klimawandels herausgestellt. Seine Analyse künftiger Risiken deckt sich mit der unseren: Ressourcenkonflikte, Migrationsdruck, Versorgungs- und Entsorgungsengpässe. Vorzubeugen, dass Reibungsverluste bei den „globalen Gütern“ die Spannungen so groß werden lassen, dass sie sich früher oder später in einem Hauen und Stechen entladen, gehört zu den großen Risikoreduktionsstrategien der Zukunft. Als Beleg dafür bekommen wir in diesen Tagen gerade täglich Bilder von Protesten gegen nicht erschwingliche Grundnahrungsmittel in verschiedenen Ecken der Welt ins Haus geliefert!
Drittens, Stabilität und globale Sicherheit:
Wer so massiv vom Ausland abhängt wie der Exportweltmeister Deutschland, dem kann nicht egal, wie die Welt tickt. In unserem ureigenen Interesse liegt, Krisen und Konflikten da zu begegnen, wo sie eine Gefahr für unser Land und seine Bürger darstellen.
Deutschland ist seit 1989 einen weiten, nicht immer einfachen und innenpolitisch kritisch begleiteten Weg gegangen. Den europäischen Kontext habe ich skizziert: Heute tun rund 7500 deutsche Soldaten, etwa 260 deutsche Zivilpolizisten und unzählige zivile Helfer Dienst in VN-geführten oder VN-mandatierten Friedensmissionen.
Deutschland duckt sich also nicht weg, wenn es um Friedensbedrohungen geht, die uns alle betreffen. Und wir könnten es auch nicht!
Wir sehen an der aktuellen Diskussion um den Bundeswehreinsatz in Afghanistan, was Verlässlichkeit im konkreten Fall bedeutet. Deutschland ist bereit, sich auch weiterhin in hohem Maße zu engagieren. Das sind wir unseren Bündnispartnern, vor allem aber den Menschen in der Region schuldig.
Afghanistan bleibt einstweilen auf starke internationale Partner, auch uns Deutsche, angewiesen. Der zivile Wiederaufbau des Landes nach 25 Jahren Krieg braucht mehr Zeit und Geduld, aber auch weiterhin eine militärische Absicherung. Oder wollen wir zulassen, dass Afghanistan, das in der Vergangenheit durch seine innere Zerrissenheit der Nährgrund für die menschenverachtende Schreckensherrschaft der Taliban und den Al-Quaida-Terrorismus war, noch einmal in Anarchie und Zerfall abgleitet?
Es gibt keinen Frieden – außer man schafft ihn. Das geht mitunter nicht ohne harte Entscheidungen ab.
Gerade deshalb ist jene europäische vorausschauende Politik gestaltender Zusammenarbeit, von der ich sprach, so wichtig. Längst taucht das Gespenst der Überforderung am Horizont auf, wenn immer neue, unverhinderte Konflikte nach Intervention schreien. Die Erfahrung zeigt: Ist erst einmal eine Intervention unvermeidbar, dauert sie lange, kostet viel und bindet viele Ressourcen, findet allerdings auch große öffentliche Aufmerksamkeit. Aber weil das so ist, müssen wir noch besser werden mit viel geräuschärmeren, weniger spektakulären Fähigkeiten; denen des Konfliktvermeidens, der Prävention und der vorausschauenden Friedenspolitik. Dafür müssen wir proaktiv werben.
Das geht nur in einer breiten Debatte. In der außenpolitisch interessierten Öffentlichkeit - wie heute Abend hier in Bremen - aber auch darüber hinaus.
Das ist keine leichte Diskussion, weil unsere Bevölkerung, deren große Mehrheit ja die Abwesenheit von Krieg als Normalfall und die Einhegung der Macht als Zivilisationsleistung erlebt hat, internationalem, zumal militärischem Engagement mit Skepsis begegnet. Ich halte das, für sich genommen, für einen ganz und gar gesunden Reflex.
Aber die Welt ist nicht mehr, dass wir von einem größeren Konflikt oder den großen Zukunftsfragen im Rahmen eines erweiterten Sicherheitsverständnisses sagen könnten: „Das geht uns nichts an!“ Es gibt keinen Urlaub von der Weltpolitik.
Beispiel und Vorbild unserer großen deutschen Friedenspolitiker zeigen, dass es keinen Frieden geben kann ohne Verantwortung. Dass Friedenspolitik sich gerade in der Balance zwischen Zukunftsglauben und nüchternem Realismus bewähren muss.
Friedenspolitisches Handeln vor dem Hintergrund regionaler und globaler Herausforderungen – das heißt mehr denn je: eine Politik, die strategische Zielsetzungen nicht scheut, gleichzeitig aber den Sinn für das Machbare bewahrt.
Um abschließend noch einmal Willy Brandt zu zitieren: „Die Bundesrepublik kennt die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Mit dieser Einsicht verbunden ist das Bewusstsein, dass sie durchaus auch Macht hat und eine Macht ist – sie versteht sich mit allen ihren Kräften als eine Friedensmacht“.