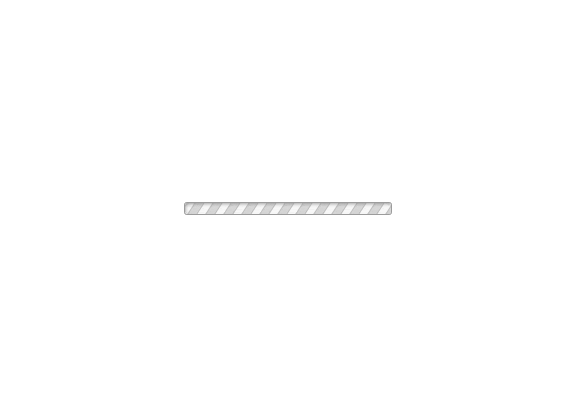Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Die Kunst des Möglichen“ – Zur Geschichte und Gegenwart der sozialdemokratischen Außenpolitik. Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier beim Berliner Forum der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand
Lieber Egon Bahr, lieber Dietmar Nietan, lieber Bernd Faulenbach!
liebe Freunde des Willy-Brandt-Hauses,
liebe Gäste der Historischen Kommission!
Ich bin Euch sehr dankbar für die Einladung, auf einer Konferenz zu sprechen, die die Außenpolitik der SPD ins Zentrum stellt – und zwar nicht nur die schwierigen Aufgaben der Gegenwart, über die wir uns in diesen Wochen viele Gedanken, und insbesondere mit Blick auf den Konflikt auf unserem eigenen Kontinent auch berechtigte Sorgen machen, sondern eine Konferenz, die das Heute in den Kontext der Geschichte der sozialdemokratischen Außenpolitik stellt; eine Geschichte, die so alt ist wie die deutsche Sozialdemokratie selbst: über 150 Jahre.
Lieber Bernd Faulenbach, ich bin ganz Deiner Meinung: Diese Übung lohnt sich!
Denn es mag ja richtig sein, dass der Markenkern der Sozialdemokratie –Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität– traditionell in der inneren, der nationalen politischen Auseinandersetzung zu verorten ist. Aber es lohnt sich, auf zwei Dinge hinzuweisen. Erstens: Schon immer hat die SPD ihre Leitwerte auch international gedacht und vertreten. Darauf haben die Historikerinnen und Historiker in der heutigen Konferenz schon viel kenntnisreicher hingewiesen als ich. Nur will ich als amtierender Außenminister einen zweiten Punkt hinzufügen, und zwar mit dem Blick auf Gegenwart und Zukunft: Je enger unsere Welt im Prozess der Globalisierung zusammenwächst – und je vernetzter insbesondere Deutschland mit dem Ausland ist (ein Prozess, der in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird)–, desto weniger kann man die Leitwerte der SPD überhaupt rein national verstehen, geschweige denn verwirklichen.
***
Zu Beginn will ich Sie aber kurz vorwarnen–ganz besonders die Parteigenossinen und -genossen im Raum–, wenn ich meine Ausführungen mit einem unerwarteten Protagonisten beginne: mit Otto von Bismarck. In wenigen Tagen jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal und dann werden wir vieles über den Reichskanzler hören und lesen. Warum sollten wir diesen Reigen nicht, mit dem gebotenen Respekt und einer Prise historischer Ironie, hier im Willy-Brandt-Haus einläuten?
Nicht um der innenpolitischen Auseinandersetzung willen erwähne ich Bismarck, den erklärten Feind der Sozialdemokratie, der es der jungen Bewegung und ihren Gründervätern wahrlich schwer gemacht hat. Sondern ich will ja auf die Außenpolitik hinaus. Bismarcks Erbe prägt deutsche Außenpolitik bis heute – nicht nur ganz allgemein, nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern auch in Bezug auf die SPD. Denn in der Auseinandersetzung mit Bismarck, in der Reibung an Bismarck weit über dessen Tod hinaus, spiegelt sich das grundsätzliche Spannungsfeld wider, das die Außenpolitik der SPD bis heute kennzeichnet: nämlich das Spannungsverhältnis von Anspruch und Wirklichkeit. Auf der einen Seite steht die sozialdemokratische Vision einer friedlichen Welt, von Gerechtigkeit und Verständigung unter den Völkern; eine Vision, die sie schon zu Bismarcks Zeiten, auch gegen Bismarck vertreten hat – doch auf der anderen Seite eine, leider auch heute, durch und durch unfriedliche Realität.
„Realpolitik“ ist das Stichwort. Bismarck war nun einmal –bei aller berechtigten Kritik an seinen Haltungen und seinen Methoden– ein Meister der Analyse, ein scharfer Beobachter der Wirklichkeit, mit einem feinen Gespür für die Interessen und Befindlichkeiten seiner politischen Mit- und Gegenspieler.
Heute vor genau 50 Jahren, also zu Bismarcks 150. Geburtstag, erschien in der Zeitung ‚Die Welt‘ ein Artikel unter der Überschrift ‚Bismarck und die Kunst des Möglichen‘. Darin heißt es: „[Bismarcks] oberste Maxime, die Politik als Kunst des Möglichen zu erkennen, ist zu oft mit dem Munde nachvollzogen und zu wenig mit Verstand befolgt worden. Denn sie bedeutet, dass […] es weder Kunst noch Politik ist, im Wunschdenken befangen zu bleiben. Statt des ‚bloß Möglichen‘ das zunächst unmöglich Erscheinende doch möglich und damit zum Gegenstand der Politik werden zu lassen, das ist die Kunst.“
Der Autor dieser Würdigung ist kein anderer als Willy Brandt! Und noch ein Detail zu diesem denkwürdigen Artikel will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die ‚Welt‘ druckte den Artikel letztlich unter dem Titel ‚Bismarck und die deutsche Sozialdemokratie‘. Daraufhin fragten einige Parteifreunde, ziemlich irritiert, warum der Parteivorsitzende einen solchen Titel gewählt habe. Da sagte Brandt, die Welt-Redaktion habe –wie das ja bis heute vorkommen soll– den Titel eigenmächtig verändert. Sein eigener Titel sei ‚Bismarck und die Politik des Möglichen‘ gewesen. Und lachend fügte Brandt hinzu: „Na, das ist doch immerhin ein Fortschritt bei der ‚Welt‘: Sie versteht die SPD als Kunst des Möglichen!“ All das, wohlgemerkt, zu einer Zeit, in der die SPD noch nie Teil einer Bundesregierung war – da lagen zwischen Willy Brandt und der ‚Welt‘-Redaktion ganz offenbar prophetische Vorahnungen in der Luft.
***
Der Außenpolitiker Willy Brandt selbst war eben beides: Friedenspolitiker und Realpolitiker. Außenpolitik sei „der illusionslose Versuch zur friedlichen Lösung von Problemen“, formuliert Brandt 1963 in einer Rede vor der Evangelischen Akademie Tutzing. Beides muss sozialdemokratische Außenpolitik auch heute vereinen: die Zielvorstellung einer friedlichen, gerechten und regelbasierten internationalen Ordnung und die Bereitschaft, den praktisch möglichen Schritt zu identifizieren und zu gehen, selbst wenn er nur klein und selbst wenn er mit Risiken behaftet ist. Ich nenne diese Mischung aus idealistischem Ziel und pragmatischem Weg „Friedensrealismus“. Solch ein Friedensrealismus steht unserer Partei bis heute gut an – auch wenn wir um die rechte Balance immer aufs Neue zu ringen haben.
Die Geschichte sozialdemokratischer Außenpolitik ist voller Beispiele dieser Spannung von Anspruch und Realität. Selbst der späte Willy Brandt bekam sie noch zu spüren. Auf dem Bremer Parteitag von 1991 forderte er: Wenn das wiedervereinte Deutschland sich an den Friedensbemühungen der Vereinten Nationen ernsthaft beteiligen wolle, dann müsse es auch zu robustem Engagement bereit sein, will sagen: deutschen Soldaten in Missionen der Vereinten Nationen. Die Parteitagsmehrheit war anderer Meinung und entschied dagegen.
Auch die anderen SPD-Kanzler fochten die Spannungen des Friedensrealismus aus. Helmut Schmidt und der NATO-Doppelbeschluss: Ich erinnere mich noch allzu gut an die Debatten – denn ich war gerade einen Monat, bevor Schmidt den Doppelbeschluss unterzeichnete, Stipendiat der Ebert-Stiftung geworden. Und Sie können sich bestimmt vorstellen, auf welcher Seite ich damals gestritten habe, in der aufgeheizten Stimmung unter uns Stipendiaten. Noch viel besser erinnere mich an die Entscheidungen der Rot-Grünen Regierung: an Schröders „Ja“ zum Kosovo-Einsatz ebenso wie sein „Nein“ zu Irak. All das waren schwierige, unbequeme Debatten – aber letztlich waren sie prägend nicht nur für die SPD, sondern für die weitere Entwicklung deutscher Außenpolitik insgesamt.
Unter den vielen Beispielen will ich mir heute drei Felder herausgreifen, deren Fortentwicklung auch heute noch entscheidend ist, um den Anspruch des „Friedenrealismus“ ins 21. Jahrhundert fortzutragen. Diese drei Felder heißen Ostpolitik, Europa und internationale Ordnung.
***
Da ist zuerst und zuvorderst Willy Brandts sogenannte „Neue Ostpolitik“. Lassen Sie mich noch einmal aus Brandts kurzem Text über Bismarck zitieren: „Zu den Realitäten gehört die geografische Lage Deutschlands in der Mitte Europas mit Russland als einem indirekten, aber unaustauschbaren Nachbarn. […] Es geht heute erst recht um die Zukunft des [deutschen] Volkes, das zwischen Ost und West lebt, zum Westen gehören will und den Ausgleich mit dem Osten braucht. Neu ist dabei die Chance, die sich aus der europäischen Entwicklung ergibt.“ Dieser Text ist 50 Jahre alt und könnte fast ein Kommentar zur heutigen Lage sein. Die Neue Ostpolitik, die Willy Brandt und Egon Bahr entwarfen, ist ein einzigartiger außenpolitischer Erfahrungsschatz und kann uns heute, in Zeiten des Ukraine-Konflikts, Orientierung bieten.
Zuvorderst gilt es, die große Errungenschaft der europäischen Friedensordnung zu erhalten. Auch dank Willy Brandts Ostpolitik ist diese Ordnung selbst in den kältesten Tagen des Kalten Krieges Schritt für Schritt herangewachsen. Eine entscheidende Etappe auf diesem Weg war die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Auf die OSZE setzen wir auch heute in unseren Lösungsansätzen für den Konflikt in der Ukraine.
In der KSZE-Schlussakte von 1975 heißt es: „Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker haben alle Völker jederzeit das Recht, in voller Freiheit, […], ihren inneren und äußeren politischen Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen.“ Durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ostukraine hat sich, erstmals seit Ende des Kalten Krieges, ein OSZE-Mitgliedsstaat, Russland, offen gegen die Souveränität eines anderen Staates und gegen diese europäische Friedensordnung gestellt. Das dürfen gerade wir Sozialdemokraten nicht ignorieren. Wir dürfen die Erfolge der Ost- und Entspannungspolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt nicht aufgeben. Wir müssen der Anwalt der europäischen Friedensordnung sein. Und deshalb haben wir im europäischen Verbund politischen und ökonomischen Druck auf Russland aufgebaut und werden solange nicht nachlassen, bis sich Russland entlang der im Minsker Abkommen aufgestellten Kriterien nachweislich und umfassend auf den Weg der friedlichen Konfliktlösung zurückbegibt. Dass wir das von der Ukraine in gleicher Weise erwarten, ist eine Selbstverständlichkeit.
***
Das ist das eine. Doch andererseits stellt Willy Brandt lakonisch fest, Russland bleibe ein „unaustauschbarer Nachbar“ Europas. Und deshalb gilt heute genau wie zu Brandts Zeiten: Nachhaltige Sicherheit für Europa wird es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Und umgekehrt wird es nachhaltige Sicherheit für Russland nicht gegen, sondern nur mit Europa geben.
Natürlich können wir nach dieser Krise nicht zurück zur Tagesordnung. Sondern es wird eine zentrale Aufgabe deutscher Außenpolitik für die nächsten Jahre, zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen und kooperative Sicherheit zwischen Russland und dem Westen neu zu verankern. Und es wird ganz besonders eine Aufgabe für diese Partei, für die SPD, die sich in ihrer Geschichte wie wohl keine andere Partei in Europa für die Überwindung des Ost-West-Gegensatzes eingesetzt hat. Nun müssen wir es wieder tun!
Sprachlosigkeit ist keine Antwort auf die Krise. Sondern wir brauchen beides: die feste Verankerung im Westlichen Bündnis, die ja Willy Brandt schon als Bürgermeister von Berlin forciert hat, und auf dieser festen Basis die Offenheit für Gesprächskanäle mit Russland, mit denen Willy Brandt in den 60er Jahren die Sprachlosigkeit des Kalten Krieges zu überwinden half. Ostpolitik heute bedeutet, diese Gesprächsforen nicht leichtfertig zu zerstören und wo nötig zu modernisieren oder umzubauen. Dazu gehört etwa der Petersburger Dialog für die Zivilgesellschaft, die vielfältigen Wirtschaftsbeziehungen, der Austausch von Wissenschaftlern und Studenten bis hinauf zu den Konsultationen zwischen den Militärs von Nato und Russland. Deutschland muss, wie zu Zeiten der Neuen Ostpolitik, der Ingenieur des Dialogs mit Russland sein.
***
Und schließlich kommt es auf das an, was Willy Brandt in dem obigen Zitat als „neue Chance“ bezeichnet: Europa. Was für Brandt eine neue Entwicklung war, ist für uns längst Alltag geworden: die Einheit Europas.
Auch das betrifft unsere Politik in der Ukraine-Krise. Es gibt heute, anders als zu Brandts Zeiten, nicht mehr einfach eine deutsche Ostpolitik gegenüber Russland, sondern es muss eine gemeinsame europäische Politik gegenüber Russland geben. Aus 28 unterschiedlichen historischen Erfahrungen und Interessen gegenüber Russland eine einstimmige Politik zu formulieren, ist schwierig. Doch es ist ein Kerninteresse der Europäischen Union – und einer europäischen Partei wie uns. Gerade Deutschland, mit der historischen Erfahrung eines geteilten Landes, das beide Blöcke erlebt hat, muss dabei helfen, die verschiedenen Perspektiven und Erinnerungen der 28 zusammenzuführen und ihnen Richtung, Takt und vor allem Maß zu geben. Die Geschlossenheit Europas ist unser außenpolitisches Pfund. Sie ist und bleibt ein Wert an sich.
***
Europas Geschlossenheit mag uns alltäglich vorkommen. Sie ist aber alles andere als selbstverständlich! Wir beobachten derzeit eine beunruhigende Entwicklung – auch diese Woche in der Presseberichterstattung: Mehr und mehr Stimmen in Europa, nicht nur in Griechenland, sehen in Deutschlands politischer und ökonomischer Stärke eine neue deutsche Hegemonie in Europa heraufziehen. Wenn die Wirtschafts- und Währungsunion Europas als Hintertür zu politischer Dominanz Deutschlands verstanden wird, dann ist das eine dramatische Fehlentwicklung. Denn das Gegenteil ist doch der Fall! Wirtschaftliche und gesellschaftliche Verflechtung, um politische Dominanz und Konfrontation für alle Zeiten zu überwinden – das ist seit jeher der wahre Treiber der europäischen Integration. Dieses große politische Projekt muss über allem ökonomischen Sachzwang stehen – und es ist Aufgabe der SPD, daran zu erinnern!
Noch ein Zitat hierzu: „[Die SPD] tritt ein für die aus wirtschaftlichen Ursachen zwingend gewordene Schaffung der europäischen Wirtschaftseinheit“ und damit letztlich „für die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa, um damit zur Interessensolidarität der Völker […] zu gelangen.“ Heidelberger Programm der SPD, 1925! Breitscheid, Scheidemann, Hermann Müller sind für diese Interessenssolidarität eingetreten – doch am Ende wurden sie übertönt und überwältigt vom Getöse des Nationalismus. Wir deutschen Sozialdemokraten von heute müssen alles tun, um die europäische Verständigung zu bewahren, die damals so tragisch gescheitert ist!
Und deshalb bin ich froh, dass ich am Sonntag ein langes und konstruktives Gespräch mit meinem griechischen Amtskollegen Kotzias führen konnte. Denn die Debatte über die griechischen Reformbemühungen, die doch eigentlich eine Debatte zwischen den Institutionen der Währungsunion und einem ihrer Mitglieder sein sollte, ist in den letzten Wochen zu einer handfesten bilateralen Belastung geworden. Jetzt haben wir als Außenminister verabredet, diese bilateralen Beziehungen neu anzupacken – weg von den Stereotypen von gestern hin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit für das gemeinsame Morgen, das auf dem unverbrüchlichen Wert der politischen Einheit Europas fußt.
***
Und schließlich gibt es ein drittes Feld, das sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der sozialdemokratischen Außenpolitik zieht: die Sehnsucht nach einer weltweiten Friedensordnung. Keine Frage ist so alt, so schwierig und so sehr geprägt von der Kluft zwischen Vision und Wirklichkeit wie diese – sie ist, sozusagen, der ‚Stein der Weisen‘ für die Friedenspartei SPD.
Schon im Eisenacher Programm von 1869 konstituiert sich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei als Teil der ‚Internationalen‘. Im erwähnten Heidelberger Programm von 1925 heißt es: „[Die SPD] fordert die Demokratisierung des Völkerbundes und seine Ausgestaltung zu einem wirksamen Instrument der Friedenspolitik.“ Im Godesberger Programm von 1959 heißt es dann: „Die Vereinten Nationen müssen die allgemeine Weltorganisation werden, die sie ihrer Idee nach sein sollen. Ihre Grundsätze sollen allgemeinverbindlich sein.“ Und schließlich fordert Willy Brandt 1982 in seiner Einleitung zum Bericht der Nord-Süd-Kommission die berühmte „Weltinnenpolitik, die über den Horizont von Kirchtürmen, aber auch über nationale Grenzen weit hinausreicht.“
Und heute? Wir erleben in diesen Monaten Kriege, Krisen und Konflikte in einer Vielzahl, Heftigkeit und Komplexität, wie sie die Welt wohl seit Willy Brandts Tagen nicht mehr gesehen hat. Und wir müssen feststellen: Diese Ballung von Krisen ist kein Zufall. Sondern sie ist symptomatisch für eine Welt, die –auch dank Staatsmännern wie Willy Brandt– ihre jahrzehntelange, bipolare Ordnung zwar überwunden hat –zum großen Glück für unser Land!-, aber an deren Stelle noch keine neue Ordnung getreten ist. Sie ist eine Welt auf der Suche.
Und wir müssen feststellen: Je enger die Welt zusammenwächst, desto heftiger prallen ihre Gegensätze aufeinander. Wirtschaftliche Globalisierung allein garantiert eben noch keine politische Annäherung, geschweige denn eine verlässliche Ordnung. Die Financial Times hat neulich formuliert: „Der Kapitalismus ist politisch polygam.“ Mehr BMWs aus Moskaus Straßen und mehr VW-Werke in China führen nicht zwangsläufig zu mehr politischer Gemeinsamkeit. Diese Einsicht widerlegt so manche Orthodoxie der 90er und 2000er Jahre. Die Krisenballung unserer Zeit entsteht eben nicht trotz, sondern wegen der Globalisierung.
Wenn ein Land darauf Antworten entwickeln muss, dann wir! Deutschland ist so vernetzt mit der Welt wie kein zweites Land. So hat es eine internationale Studie kürzlich nachgewiesen – und zwar nicht nur für Handels- und Kapitalströme, sondern auch bei der Migration von Menschen und Datenflüssen im Internet. Das heißt im Umkehrschluss: Deutschland ist wie kein zweites Land auf eine verlässliche und regelbasierte internationale Ordnung angewiesen.
Unser Engagement für internationale Ordnung mag man also mit reinstem deutschen Eigeninteresse begründen – ich sehe darin aber zugleich unsere Verantwortung. Denn wer so überdurchschnittlich von europäischer und internationaler Ordnung profitiert –und das haben wir in den letzten Jahren ganz gewiss!-, der ist verpflichtet, zu diesem gemeinsamen Gut auch überdurchschnittlich beizutragen. Und das gilt eben nicht nur für die langen Linien der globalen Ordnung: für die Stärkung der Vereinten Nationen, zum Beispiel die Zukunft des Peacekeeping, oder für neue Elemente von Ordnung, zum Beispiel im digitalen Raum durch die Arbeit an einem „Völkerrecht des Netzes“. Sondern diese Verantwortung gilt auch im täglichen Krisengeschehen – in unserem Eintreten für europäische Friedensprinzipien in der Ukraine-Krise ebenso wie für den inneren Zusammenhalt der europäischen Ordnung, die in der Griechenland-Krise unter Druck geraten ist.
Damit bin ich am Ende zurück beim Grundthema von großen Visionen und alltäglicher Realität – der ‚Politik der kleinen Schritte‘; der Hartnäckigkeit oder, wie es ein Journalist kürzlich ausgedrückt hat, der „Penetranz der Diplomatie“. Darf ich noch ein letztes Mal jenen erstaunlichen kleinen Text von Willy Brandt über Bismarck zitieren? „Der dauernde Versuch, einen Ausgleich der Interessen zu suchen, die Punkte herauszuarbeiten, an denen sich die eigenen Interessen mit denen des Gegners treffen, im Gespräch mit dem politischen und geistigen Gegner zu bleiben, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren, mit sicherem Gespür für Entwicklungen des internationalen Kraftfeldes den kleinen Schritt nicht zu verachten, wenn der größere ungefährdet noch nicht gegangen werden kann – das ist die Methode der bismarckschen Außenpolitik.“
März 1965. Anderthalb Jahre später wird der Verfasser selbst deutscher Außenminister, als erster Sozialdemokrat in der Bundesrepublik. Und so sage ich am Ende, mehr unter Berufung auf den Autor denn auf seinen Gegenstand: Außenpolitik von heute ist mehr als die Entscheidung zwischen dem Auslandseinsatz der Bundeswehr oder folgenlosem diplomatischen Gerede. Es ist der mühsame Prozess, mit ehrlicher Analyse, mit Geduld und Beharrlichkeit und selten ohne eigenes Risiko, scheinbar Festgefahrenes zu lösen; widerstreitende Konfliktparteien zueinander zu bringen; zu wissen, dass es im Konflikt nur selten eine Wahrheit gibt; auf Vereinfachung zu verzichten und immer wieder zu versuchen, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen. Wer das tut, wer sich den einfachen Antworten verweigert, wird auf vordergründigen Beifall verzichten müssen, weil er schnelle Lösungen nicht bieten kann. Aber wir sollten gelernt haben, dass die schnellen und scheinbar entschiedenen Lösungen die Welt nicht besser hinterlassen als sie sie vorgefunden haben. Das jüngste Beispiel, Libyen, sollte uns daran erinnern. Deshalb können wir selbstbewusst die Partei sein, weniger für die einfachen Antworten, sondern für diejenigen eintreten und kämpfen, die tragen, die zusammenführen, die Vertrauen neu begründen, wo es verloren gegangen ist. Willy Brandt hat bewiesen, dass dieser Weg sich lohnt. Deshalb fühle ich mich –mehr noch als unter dem Konterfei Bismarcks, das im Auswärtigen Amt auch seinen Platz an der Wand hat– wohl unter der Skulptur dieses Mannes, der seit 15 Monaten am Werderschen Markt direkt meinem Schreibtisch wieder über die Politik des deutschen Außenministers wacht.