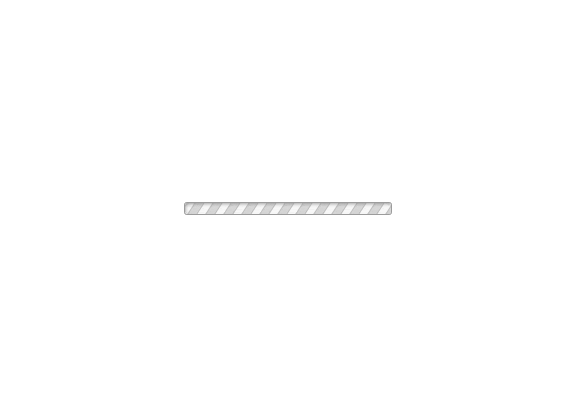Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts
„Wege zum gerechten Frieden? Politik für Europa und die Welt in christlicher Verantwortung“ - Rede von Staatsminister für Europa Michael Roth bei der Herbsttagung der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck am 24. November 2014
--es gilt das gesprochene Wort--
Meine Damen und Herren,
wir leben derzeit in außenpolitisch stürmischen Zeiten. Wohin wir auch schauen auf der Welt: Krisen, Unordnung und Gewalt. Die aktuellen Krisenherde sind Ihnen allen bekannt: Die Lage in der Ost-Ukraine hat sich in den vergangenen Tagen erneut gefährlich zugespitzt. Die Gefahr einer offenen militärischen Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine liegt wieder in der Luft.
Auch aus Syrien erreichen uns Tag für Tag schreckliche Bilder: Über 200.000 Tote, mehr als 7 Millionen Vertriebene – so lautet die verheerende Bilanz nach vier Jahren Bürgerkrieg.
Im Nordirak werden wir derzeit Zeugen des scheinbar unaufhaltsamen Vormarsches der Terrorgruppe Islamischer Staat, die eine Religion schändlich missbraucht und im Namen des Islam barbarische Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen begeht.
Auch der Nahost-Konflikt ist wieder aufgeflammt: Seit Tagen gibt es rund um den Tempelberg in Jerusalem immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen und Anschläge. Eine neue Intifada – ein Kampf der Religionen – droht.
Und nicht zuletzt erleben wir durch die rasante Verbreitung des Ebola-Virus in Westafrika eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Trotz internationaler Hilfsanstrengungen bedroht die Epidemie inzwischen den Frieden und die Sicherheit in der ganzen Region.
Ich will mich hier sämtlicher Superlative enthalten. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zuvor mit einer solchen Vielzahl von Krisen und Konflikten konfrontiert waren – und das gleichzeitig und in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das verlangt der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik momentan alles ab.
Wie gut es doch tut, in diesen stürmischen Zeiten zu Ihnen ins Kloster Haydau nach Morschen zu kommen! Hier – fernab vom hektischen Trubel in Berlin – habe ich gemeinsam mit Ihnen die Gelegenheit, um innezuhalten und die Dinge mit etwas mehr Ruhe und Weitblick zu betrachten.
Ich freue mich darüber, heute Abend mit Ihnen über die aktuellen Bewährungsproben für die deutsche Außen- und Europapolitik ins Gespräch zu kommen. Mir geht es dabei vor allem um die Frage, wie wir Politik für Europa und die Welt in christlicher Verantwortung gestalten können.
Nicht erst seit meiner Ernennung zum Europa-Staatsminister im Auswärtigen Amt im Dezember letzten Jahres, sondern seit über 16 Jahren als Bundestagsabgeordneter, begleitet mich eine Frage: Christsein und politisches Handeln – wie lassen sich diese beiden Welten miteinander in Einklang bringen? Oder ganz konkret gefragt: Was bedeutet mein Christsein eigentlich für meine politischen Überzeugungen und Entscheidungen?
Es ist ja nicht so, dass man seinen Glauben einfach so wie einen Mantel an der Garderobe abgibt, wenn man Parlamentarier wird oder ein Büro im Auswärtigen Amt bezieht. Für mich als Christ ist mein Glaube auch im politischen Leben ein Begleiter und ein Ratgeber. Das heißt nicht, dass ich Politik mache mit der Bibel in der Hand. Aber oft muss ich schmunzeln, wenn ich beim morgendlichen Blick auf die Tageslosung feststelle, dass das Wort Gottes auch zu tagespolitischen Fragen durchaus etwas beitragen kann.
Aber nicht im Sinne eines zielgenauen Navigationssystems, sondern eher im Sinne eines Kompasses, der uns die Richtung weist – wie es Nikolaus Schneider kürzlich formuliert hat. Die Bibel schenkt uns – bis auf wenige Ausnahmen – keine eindeutigen Handlungsanweisungen für konkrete politische Entscheidungen. Aber sie gibt uns ein Fundament, eine Richtschnur für unser politisches Handeln.
Doch hundertprozentige Gewissheit kann uns auch unser Glaube nicht verschaffen. Sonst hieße es ja auch Wissen - und eben nicht Glauben. Manchmal stellt er uns sogar vor ein Dilemma, aus dem wir so schnell keinen Ausweg finden. In der komplexen Wirklichkeit in der wir leben, haben wir uns fast schon an die großen Fragezeichen und das „Ja, aber…“ gewöhnt, die über jeder unserer Entscheidungen schweben. Auch wenn wir uns oft nach mehr Klarheit und Einfachheit sehnen, müssen wir feststellen: Die Welt um uns herum ist eben nicht einfach nur Gut oder Böse, Schwarz oder Weiß.
Sie besteht vielmehr aus einer Palette ganz unterschiedlicher Graustufen und Schattierungen.
In einer solchen Welt, in der es immer seltener einfache, eindeutige Antworten auf unsere Fragen gibt, ist es als Politiker oftmals schwer zu erkennen, was richtig und was falsch ist, auf wessen Seite man sich stellen und welchen Weg man beschreiten will. Doch von allen Seiten schallt uns unüberhörbar der Ruf entgegen „Tut doch endlich was!“ – ob nun bei Kriegen, Terrorismus, Flüchtlingskatastrophen oder Epidemien. Ignorieren können wir diese Rufe nicht, sie zwingen uns zum Handeln – auch auf die Gefahr hin, dass wir selbst nach sorgfältiger Abwägung aller Risiken am Ende doch die falsche Entscheidung treffen.
Wenn ich eines in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt habe, dann das: Am Ende tragen wir so oder so die Verantwortung – für unser Handeln genauso wie für unser Nicht-Handeln. Und wir machen uns bisweilen schuldig. So oder so. Durch Tun oder eben auch durch Nicht-Tun. Den Blick abwenden, sich wegducken, sich heraushalten bedeutet die Flucht vor der Verantwortung. Doch eines ist klar: Vor der Verantwortung können wir weglaufen, nicht aber vor den Folgen unseres Nicht-Handelns.
Das gilt für Politiker genauso wie für jeden Christen im Alltag. Im Matthäus-Evangelium gibt es eine Stelle, in der es um das Jüngste Gericht geht, die dies schön verdeutlicht. Sie kennen sie alle: „Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht […] Wahrlich ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem unter diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.“ (Matthäus 25, 42-43, 45). Dies ist eine deutliche Ermahnung an uns Christinnen und Christen, nicht wegzuschauen, wenn Menschen in Not geraten.
In diesem Sinne war auch die Reformation, deren 500. Jahrestag wir seit 2007 mit der Lutherdekade begehen, ein Wendepunkt für das Verhältnis von Christen und der Welt: Denn Martin Luther verstand sich ja nicht nur als Mönch und Reformator, sondern auch als „politischer Mensch“. Er bezog Position und vertrat diese auch vor den Autoritäten. Und er hatte eine klare Botschaft an uns alle: Mischt Euch ein! Schaut nicht weg! Nehmt Eure Verantwortung vor Gott und der Welt ernst!
Die Reformation brach mit der Lehre, dass der Mensch sich im Laufe seines Lebens zuallererst um das eigene Seelenheil kümmern müsse. Und gerade deshalb können wir – Luther würde vielleicht sagen – müssen wir uns um andere kümmern! Unsere Freiheit bezeugen wir gerade dadurch, dass wir Verantwortung für die Welt und unsere Mitmenschen übernehmen.
Was bedeutet diese Handlungsmaxime in der heutigen Welt? Einer Welt, in der uns Konflikte tagtäglich vor Augen führen, wie weit das Ideal eines friedlichen Miteinanders von der Wirklichkeit entfernt ist. Einer Welt, in der sich – gerade auch in Deutschland – viele Menschen resigniert von den Krisenherden abwenden und sagen: „Die Lage ist so verfahren – was können wir da schon tun?“.
Um in dieser immer unübersichtlicheren Welt wieder Orientierung zu finden, kann uns unser Glaube als innerer Kompass helfen. Doch auch der Blick zurück auf unsere Geschichte gibt uns Halt und erdet uns wie ein Anker. Das geht auch mir so. Sie müssen wissen: Mein Leben als Staatsminister besteht derzeit zu einem großen Teil aus Reisen und Reden – und Zuhören. Die vergangenen Monate waren für mich aber auch so etwas wie eine Zeitreise durch ein ganzes Jahrhundert in der wechselhaften Geschichte Europas. Denn 2014 kann man angesichts der vielen Jahrestage getrost auch als „Jahr der Erinnerung“ bezeichnen. All diese Gedenktage stehen symbolisch für einschneidende Wendepunkte, die über Krieg und Frieden entschieden haben.
Eine meiner vielen Reisen durch Europa führte mich nach Sarajevo, wo vor 100 Jahren mit den Schüssen auf den österreichischen Thronfolger die Katastrophe des Ersten Weltkriegs ihren Lauf nahm. Auch in Belgien und Frankreich habe ich gemeinsam mit Bundespräsident Joachim Gauck an Gedenkveranstaltungen zum Beginn des Ersten Weltkriegs teilgenommen – am Hartmannsweilerkopf im Elsass und in Lüttich. Besonders bewegend war – 75 Jahre nach dem deutschen Überall auf Polen – der Besuch im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Ein Ort des Grauens, der einen die Monstrosität des Holocaust auf beklemmende Art und Weise spüren lässt.
An diesen Orten, an denen Europa all das verraten hat, was seine Werte, seine Kultur und seine Zivilisation eigentlich ausmacht, an denen von Deutschen und in deutschem Namen grausame Verbrechen begangen wurden, kommt einem eine Frage unausweichlich in den Kopf: Wo war Gott in diesen Jahren? Wie konnte Gott nur so unendlich viel Leid und Unrecht zulassen?
Bei meinem Besuch im Auschwitz begegnete ich Marian Turski, einem Überlebenden des Holocaust. Eine beeindruckende Persönlichkeit, die ihr Leben der Erinnerung und der Versöhnung gewidmet hat! Im Gespräch sagte mir Marian Turski: „Die Frage 'Wo war Gott in Auschwitz?' ist falsch. Die Frage muss doch eigentlich lauten: Wo war der Mensch in Ausschwitz? Wo war die Menschlichkeit?“
Und Marian Turski hat doch recht: Machen wir es uns nicht viel zu einfach, wenn wir mit dem Finger vorwurfsvoll auf Gott weisen? Denn es waren doch Menschen, die in Ausschwitz, am Hartmannsweilerkopf, in Lüttich oder anderswo buchstäblich alle Mittel eingesetzt haben, um sich gegenseitig zu vernichten. „Es ist eben allein der Mensch, der unmenschlich handeln kann“, so brachte es Bundespräsident Gauck kürzlich auf den Punkt. Diese Orte des Schreckens stehen heute auch als mahnendes Beispiel dafür, was geschieht, wenn der Mensch Gott aus den Augen verliert, wenn Menschen gottlos handeln und damit zu Unmenschen werden.
Ich habe bei meinen Reisen und Begegnungen in ganz Europa unglaublich viel gelernt – über Deutschland, über die Wahrnehmung unserer gemeinsamen Geschichte in unseren Nachbarländern und über das, wozu Menschen fähig sind – im negativen wie im positiven Sinne. Manche mögen Gedenkveranstaltungen vielleicht für etwas Ritualisiertes halten – andere sogar für reine Geldverschwendung. Ich aber empfehle jedem EU-Gegner, diese Orte der Erinnerung zu besuchen. Vielleicht spüren dann auch die ewigen Nörgler und Skeptiker endlich, wie kostbar das vereinte Europa für uns ist: Denn die EU ist unsere Antwort auf Krieg, Nationalismus und Faschismus.
Tage der Erinnerung, wie wir sie in diesem Jahr so zahlreich begehen, sind wichtig. Aber wem sage ich das, liebe Brüder und Schwestern! Wir kommen traditionell zusammen zwischen dem Ewigkeitssonntag und dem ersten Advent. Eine Zeit der Einkehr, der Vorfreude, aber eben auch der Erinnerung an das ewige Leben und Gottes unendliche Liebe, die er uns durch seinen Sohn Jesus Christus schenkt. Tage der Erinnerung helfen uns, unsere Gegenwart und Zukunft besser zu verstehen. Erst in der Rückschau können wir ermessen, welch langen Weg wir in Europa gehen mussten, um dorthin zu kommen, wo wir heute stehen:
In Europa regiert nicht mehr das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Aus Feinden sind über die Jahrzehnte Partner und Freunde geworden. Heute zielen wir nicht mehr mit Waffen aufeinander, sondern wir diskutieren in den Brüsseler Verhandlungsräumen über politische Kompromisse – manchmal hart, aber stets gemäß den Regeln, die wir miteinander vereinbart haben. Und was wir in den vergangenen Jahrzehnten gemeinsam erreicht haben, ist auch weit mehr als nur ein Binnenmarkt und eine Währungsunion: Europa ist vor allem auch eine Werteunion, eine Rechtsstaatsfamilie, eine Solidargemeinschaft!
Wir haben in Europa glücklicherweise die richtigen Lehren aus der Geschichte gezogen. Ein Krieg zwischen zwei Mitgliedstaaten ist heute unvorstellbar. Doch dafür sind wir vor unserer Haustür mit immer mehr Krisenherden konfrontiert. Nicht zuletzt die zunehmende Zahl von Flüchtlingen, die derzeit in Europa Schutz und Sicherheit suchen, führt uns deutlich vor Augen: Auch wenn in der EU seit Jahrzehnten Frieden herrscht, leben wir mitnichten in friedlichen Zeiten!
Das Besondere ist nicht allein die Häufung der Krisenherde, sondern, dass sie sich praktisch alle in unserer unmittelbaren Nachbarschaft abspielen und direkte Rückwirkungen auf Europa haben. Man kann sagen: Die Krisen dieser Welt sind näher an uns herangerückt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Wir können uns bei diesen Konflikten nicht einfach wegducken und raushalten. Die EU wird sich künftig noch stärker als bisher außen- und sicherheitspolitisch einbringen müssen.
Besonders von Deutschland als größtem Mitgliedstaat der EU erwarten viele unserer Partner, dass wir uns gerade in Krisenzeiten weltweit noch stärker engagieren und Verantwortung übernehmen. Die Deutschen selbst sehen das offenbar etwas anders. Eine Umfrage der Körber-Stiftung hat kürzlich ergeben: Nur 37 Prozent der befragten Deutschen sind dafür, dass unser Land mehr außenpolitische Verantwortung übernimmt; etwa 60 Prozent sehen das eher skeptisch.
Wir sehen uns also mit einem tiefen Graben konfrontiert – einem Graben zwischen den hohen Erwartungen unserer Partnerländer und einer zunehmend skeptischen öffentlichen Meinung. Keine Frage: Die deutsche Außenpolitik muss sich über solche Gräben hinweg bewegen, um auch in Zukunft handlungsfähig zu bleiben. Das ist ein echter Balanceakt, dem wir uns stellen müssen!
Deshalb hat mein Ministerium vor einigen Monaten den Startschuss für eine kritische Selbstüberprüfung der deutschen Außenpolitik gegeben. Dieser „Review-Prozess“ steht unter dem Motto „Außenpolitik Weiter Denken“. Die Diskussion darüber findet mit außenpolitischen Experten aber auch in Veranstaltungen mit der breiten Öffentlichkeit in Deutschland und Europa statt. Ziel ist also, eine öffentliche Debatte über die deutsche Außenpolitik anzustoßen und Rückschlüsse daraus zu ziehen, wo eine Anpassung unsere Politik notwendig sein könnte.
Wenn Sie mich fragen: Ja, Deutschland sollte künftig mehr Verantwortung in der Welt übernehmen – aber immer eingebettet in die Strukturen der Europäischen Union, also immer als ein Spieler im gesamteuropäischen Team. Denn nur wenn alle Mitgliedstaaten außenpolitisch an einem Strang ziehen, bringt Europa das politische Gewicht auf die Waage, das Deutschland zur Realisierung seiner nationalen Interessen braucht. Oder anders herum: Wenn wir uns in der EU nicht einig werden, wird es für Deutschland sehr schwer, seine internationalen Ziele zu erreichen. Keine Frage: Die Europäische Union ist Deutschlands wichtigstes außen- und sicherheitspolitisches Instrument.
Das kann aber nur gelingen, wenn sich die EU auch künftig nicht spalten lässt, nach außen mit einer Stimme spricht und geschlossen handelt. Dies wird zu den wichtigsten Aufgaben der neuen Hohen Vertreterin der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, gehören, die vor wenigen Tagen ihr Amt angetreten hat.
Zum anderen werden wir noch stärker als bislang ein besonderes Augenmerk auf unsere unmittelbare Nachbarschaft richten müssen. Bei unseren Nachbarn in Osteuropa oder im südlichen Mittelmeerraum ist die Anziehungskraft der Europäischen Union weiter ungebrochen. Die Demonstrationen auf dem Maidan in Kiew, dem Tahrir-Platz in Kairo oder dem Taksim-Platz in Istanbul stehen beispielhaft für den Wunsch der Menschen nach demokratischer Teilhabe, Rechtsstaatlichkeit und einem Leben in Frieden und Wohlstand. Das sollte uns Ansporn und Verpflichtung sein, den engen Dialog, den wir mit diesen Ländern bereits pflegen, noch weiter auszubauen.
Es ist nicht nur im Sinne eines stabilen geopolitischen Umfeldes in unserem Interesse, aktiv dabei mitzuarbeiten, dass Konflikte in unserer unmittelbaren Nachbarschaft friedlich gelöst werden. Auch aus der Entstehungsgeschichte der EU ergibt sich die Verantwortung, Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in unseren Nachbarländern zu fördern. Schließlich fordert der EU-Vertrag in Artikel 8, einen „Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut“.
Eine leichte Aufgabe ist dies allerdings nicht. Denn praktisch jede der aktuellen Krisen stellt uns vor Fragen, auf die es keine eindeutigen und schon gar keine einfachen Antworten gibt. Zum Beispiel diese: Wie können wir unseren östlichen Nachbarn und NATO-Bündnispartnern unsere Solidarität signalisieren, ohne dass Russland dies als Vorwand zu neuer militärischer Eskalation nutzt? Wie schaffen wir es, weiter Druck auf Russland auszuüben, ohne gleichzeitig die Gesprächskanäle nach Moskau zuzuschütten?
Selten zuvor hat es einen internationalen Konflikt gegeben, in dem die Bundesregierung so intensiv um eine diplomatische Lösung gerungen hat. Es darf nicht sein, dass fast 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa wieder Grenzen gewaltsam verschoben werden. Es darf nicht sein, dass 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa der Wunsch der Menschen nach Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit missachtet wird. Wir können nicht akzeptieren, dass Russland die europäische Friedensordnung massiv beschädigt, grundlegende Prinzipien des Völkerrechts in Frage stellt und Europa damit an den Rand einer neuen Spaltung führt.
Wir haben deshalb die völkerrechtswidrige Annexion der Krim ebenso wie das russische Vorgehen in der Ost-Ukraine von Beginn an mit Nachdruck verurteilt. EU und NATO haben geschlossen reagiert. Nicht zuletzt das einige Vorgehen der EU – einschließlich der zunehmende wirtschaftliche Druck auf Russland durch die vereinbarten Sanktionen – hat dazu beigetragen, dass mit dem Minsker Abkommen vom 5. September die Eskalationsspirale vorläufig gestoppt werden konnte. Aber die Gefahr einer erneuten Zuspitzung der Krise ist noch nicht gebannt. Der Waffenstillstand ist fragil, immer wieder gibt es Gefechte und auch Tote.
Jetzt geht es darum, dass wir weiter an einer politischen Lösung arbeiten. Meine Generation hat das Glück gehabt, dass sie keinen Krieg mehr erleben musste. Gerade wir haben die Pflicht, Europa den Rückfall in längst überwundene Gegensätze zu ersparen. Ob uns das gelingt, ist nicht sicher. Wir müssen aber immer drauf vertrauen: Selbst in festgefahrenen Konflikten kann Außenpolitik, kann die Diplomatie etwas bewegen. Mit Augenmaß, Geduld, Gradlinigkeit und dem unbeirrbaren Willen zu verhandeln und auch andere Standpunkte wahrzunehmen. Und in dem Wissen, dass es immer Alternativen zum Krieg gibt.
Politik ist das Bohren dicker Bretter. Das wusste nicht nur der Soziologe Max Weber. Auch unser Außenminister Steinmeier kann nach unzähligen Vermittlungsgesprächen mit der russischen und der ukrainischen Seite sein ganz eigenes Lied davon singen.
Und auch ich habe diese Erfahrung in den vergangenen Monaten gemacht. Wer schnelle Erfolge will, der ist in der Außen- und Europapolitik sicher fehl am Platz. Seit Jahren setze ich mich dafür ein, dass die Europäische Union elementare Grundwerte – wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, den Schutz von Minderheiten oder Presse- und Meinungsfreiheit – nicht nur gegenüber Drittstaaten wie China oder Russland einfordert. Wir müssen diese Werte auch im Innern uneingeschränkt vorleben und schnell reagieren, wenn sie in Bedrängnis geraten. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer der Fall.
Dieses Thema ist mir ein Herzensanliegen – und ich habe es sozusagen mitgenommen vom Bundestag in mein neues Amt als Europa-Staatsminister.
Es begann vor etwa zwei Jahren mit einer vagen Idee, daraus entstand ein erster Namensbeitrag in der FAZ. Im November 2013 hatte es die Idee einer „Grundwerteinitiative“ nach zähen Verhandlungen tatsächlich in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition geschafft – das war ein hartes Stück Arbeit. Dann, im neuen Amt als Staatsminister, ging es darum, bei unseren europäischen Partnern Unterstützer zu gewinnen, um aus der Idee endlich auch politische Realität werden zu lassen.
Das bedeutete „Klinkenputzen“ und Überzeugungsarbeit leisten. In vielen bilateralen Gesprächen erntete ich zunächst oft freundliches Schweigen, als ich das Thema ansprach. Beim zweiten Versuch verlief das Gespräch schon konstruktiver, bei der dritten Unterhaltung ging es plötzlich schon um konkrete Details. Ich spürte: Es tut sich etwas. Langer Atem und Beharrlichkeit zahlen sich eben doch aus. Immer mehr Unterstützer kamen hinzu. In der vergangenen Woche befasste sich der Allgemeine Rat (das ist das monatliche Treffen der EU-Minister der Mitgliedstaaten) in Brüssel zum wiederholten Male mit der Grundwerteinitiative. Ein langer Marathonlauf nähert sich langsam der Ziellinie: Wir stehen in der Europäischen Union kurz davor, allgemeine, objektive und verbindliche Standards und einen politischen Prozess für eine konsequente Beachtung der Grundwerte zu vereinbaren.
Was ich damit sagen will: Enttäuschungen und Rückschläge gehören in der Außen- und Europapolitik zum Berufsalltag. Damit umzugehen und die Kraft aufzubringen, weiterzumachen, darum geht es doch und vielleicht ist auch das Teil unserer christlichen Verantwortung. Wir Menschen sind von Gott zur Übernahme von Verantwortung befähigt. Aber wir bleiben begrenzt und fehlbar. Und wohl niemand hat es besser beschrieben als Dietrich Bonhoeffer. In einem seiner Gedichte, die er 1944 während seiner Haft verfasste, heißt es:
„Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen schweben, sondern das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend umfangen.“
Aber auch im Hinblick auf die Lage im Nordirak wurden uns Politikern zuletzt Entscheidungen abverlangt, die schwierig und zugleich weitreichend waren: Unterstützen wir die kurdische Regionalregierung auch mit militärischer Ausrüstung? Sind wir bereit, das Risiko einzugehen, dass diese Waffen später einmal in die falschen Hände fallen könnten? Oder beschränken wir uns auf rein humanitäre Unterstützung und riskieren das Erstarken eines menschenverachtenden Terrorstaates und das Versinken einer ganzen Region in Blut und Chaos?
Die Entscheidung der Bundesregierung für die Waffenlieferungen war richtig. Es gilt nicht nur das grausame Wüten der Terrororganisation Islamischer Staat zu stoppen, sondern auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit in Europa abzuwenden. Denn wir müssen uns auch fragen: Wie kann es sein, dass junge Menschen, die mitten unter uns in Deutschland aufwachsen, in den Bann von Hass und Terror fallen und zum Morden in den Nahen Osten ziehen? Und was tun wir, wenn diese derzeit über 400 Menschen – fanatisiert und traumatisiert – in unser Land zurückkehren und ihre Vorstellungen hier verwirklichen wollen?
Ich kann Ihnen versichern: Niemand in der Bundesregierung hat sich die Entscheidung, Waffen an die kurdische Regionalregierung zu liefern, leicht gemacht. Und es handelt es sich auch nicht – wie manche behaupten – um einen Paradigmenwechsel oder gar einen Tabubruch in der deutschen Außenpolitik. Nein, es ging um eine Ausnahmeentscheidung in einem konkreten Einzelfall. Natürlich galt es bei der Frage „Liefern wir Waffen oder nicht?“ die Risiken sorgsam abzuwägen. Aber hier war klar: Das, was ist, wiegt zweifellos schwerer als das, was sein könnte.
Was mich an der öffentlichen Diskussion in Deutschland bisweilen stört, ist das Zerrbild von der vermeintlichen „Militarisierung der deutschen Außenpolitik“, das einige Kritiker immer wieder zu zeichnen versuchen. Auch im Falle der Waffenlieferungen in den Irak haben wir eine isolierte Debatte über militärische Maßnahmen erlebt. Und das, obwohl Deutschland sich darüber hinaus vielfach engagiert – in erster Linie diplomatisch-politisch oder mit humanitärer und wirtschaftlicher Unterstützung.
Lassen Sie mich nur zwei Beispiele nennen: Ende Oktober fand im Auswärtigen Amt unter Schirmherrschaft von Außenminister Steinmeier eine internationale Flüchtlingskonferenz statt, die ermutigende Signale der Unterstützung für die Nachbarländer Syriens erbracht hat, die Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben. Und erst vergangene Woche hat das Bundeskabinett den vierten Bericht zum Aktionsplan zivile Krisenprävention verabschiedet. Damit machen wir deutlich: Es ist uns ernst mit der Krisenprävention und dem Vorrang für das Zivile!
Die Asymmetrie der deutschen Debatte lässt sich vermutlich auch darauf zurückführen, dass der Deutsche Bundestag öffentlichkeitswirksam über Militäreinsätze entscheidet, während andere zivile Instrumente eher im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Bisweilen wünschte ich mir, wir hätten in Deutschland nicht nur eine „Parlamentsarmee“, sondern wir Abgeordneten würden ebenso öffentlichkeitswirksam über die Entsendung von humanitärer oder wirtschaftlicher Hilfe abstimmen. Dann würde nämlich deutlich werden, dass der Vorwurf der vermeintlichen Militarisierung wenig mit der Realität zu tun hat.
Mit Interesse habe ich auch die jüngste Pazifismus-Debatte in unserer evangelischen Kirche verfolgt: Auf der einen Seite des Spektrums steht da der bedingungslose Pazifismus einer Margot Käßmann, die Waffengewalt grundsätzlich ablehnt und von der Abschaffung der Bundeswehr träumt. Das ist ein schöner, ja legitimer Traum, den man durchaus teilen kann. Aber ist er auch realistisch? Und können wir so tatsächlich den Weltfrieden sichern und Menschenleben schützen? Ich fürchte nicht!
Ich halte es da eher mit Wolfgang Huber, Käßmanns Vorgänger im Amt des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, der seine Haltung mit dem etwas sperrigen Begriff des „Verantwortungspazifismus“ umschrieben hat. Huber hat Recht, wenn er sagt: „Pazifismus heißt nicht Passivität. Pazifisten sind nicht diejenigen, die alles geschehen lassen. Pazifisten sind diejenigen, die Frieden machen“. Und das bedeutet eben auch, dass unsere Verantwortung für den Frieden im äußersten Notfall auch den Einsatz von Waffengewalt einschließen kann.
Dieses Handlungsprinzip ist im Übrigen sogar völkerrechtlich anerkannt: Als Konsequenz aus dem grausamen Völkermord in Ruanda haben die Vereinten Nationen vor einigen Jahren das Konzept der „Schutzverantwortung“ (englisch: responsibility to protect) entwickelt. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, die hilflose Zivilbevölkerung notfalls auch mit militärischen Mitteln vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Brüchen des humanitären Völkerrechts zu schützen.
Und so hat es die EKD im Jahr 2007 auch in ihrer Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ formuliert, an der ich selbst mitarbeiten durfte. „Wer den Frieden will, der muss den Frieden vorbereiten“, heißt es dort. Frieden fällt eben nicht einfach so vom Himmel ohne unser eigenes Zutun. Und manchmal müssen wir erkennen, dass erst eine militärische Intervention die Grundlage für eine spätere politische Lösung und einen dauerhaften Frieden schafft.
Ich bin überzeugt: Deutschland ist im Verbund mit seinen Partnern in Europa gut aufgestellt, um die „stürmischen Zeiten“ mit ihren großen außen- und sicherheitspolitischen Bewährungsproben zu meistern.
Entscheidend für mich als Politiker und Christ ist es, diese außenpolitischen Fragestellungen immer auch in einen christlichen Kontext zu stellen. Der Glaube gibt mir Kraft und Zuversicht, dazu in christlicher Verantwortung beizutragen. Die Handlungsmaximen, die ich aus meinem evangelischen Glauben in die Politik mitbringe, helfen mir, im politischen Alltag meinen Kompass auszurichten und die Orientierung zu behalten.
Unser Glaube gibt uns einiges mit an die Hand, was uns Christen hilft für unser Wirken hier in der Welt. Gott hat uns in die Verantwortung für die Welt hinein gestellt. Es ist an uns, diese Verantwortung anzunehmen. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Es ist unser Auftrag, die Welt im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Stück besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben. Deshalb sollten unsere Kerzen eben nicht nur in der Kirche und während unserer Synodaltagungen brennen. Sie spenden Licht in einem Flüchtlingscamp, im Asylbewerberheim, in einer Parteiversammlung und in einer Kabinettsitzung. Wir alle wissen: Das Reich Gottes vermögen wir nicht auf Erden zu bauen. Aber jeder von uns kann mithelfen, den Weg dahin zu ebnen.